Gefährlicher Online-Trend zwischen Selbstoptimierung und Selbstzerstörung
„Looksmaxxing“ – die gezielte Optimierung des eigenen Aussehens – liegt bei jungen Männern im Trend. Eine aktuelle Studie in Sociology of Health & Illness zeigt: In der „Manosphere“ wird aus Selbsthilfe schnell Selbstzerstörung. Bodyshaming, riskante Eingriffe und massive psychische Belastungen bis hin zu Suizidgedanken sind die Folge.
 ©lielos / stock.adobe.com
Die Community propagiert Selbstoptimierung als den Weg für junge Männer hin zum „Erfolg bei Frauen“ und zu gesellschaftlicher Anerkennung. Daraus entsteht ein Sog zu medizinischer Selbstveränderung mit teils schlimmsten Folgen.
©lielos / stock.adobe.com
Die Community propagiert Selbstoptimierung als den Weg für junge Männer hin zum „Erfolg bei Frauen“ und zu gesellschaftlicher Anerkennung. Daraus entsteht ein Sog zu medizinischer Selbstveränderung mit teils schlimmsten Folgen.
Im Zentrum der Untersuchung stand ein Onlineforum mit rund sechs Millionen Besuchern pro Monat. Die Forschenden analysierten über 8.000 Kommentare in zwei besonders aktiven Unterforen: eines für Selbstoptimierung (z. B. Fitness, Hautpflege, Operationen), das andere für das Hochladen und Bewerten von Fotos. Ziel der Community sei es, Männer durch Maßnahmen wie „Mewing" (Zungenhaltung zur Kieferoptimierung), Gewebe-Filler oder chirurgische Eingriffe „aufzuwerten“, wie die Autoren der Studie eingangs schreiben.
Doch statt gegenseitiger Unterstützung herrsche vielmehr ein rauer Ton. Die Autoren sprechen von einem „hegemonial-maskulinen Blick“, der Körper nach scheinbar objektiven Kriterien vermesse und Männer öffentlich degradiere – etwa wegen einer „zu langen Philtrumlänge“ oder eines „kindlichen Unterkiefers“. Bewertet werde mit der PSL-Skala (nach einschlägigen Manosphere-Foren benannt), auf der Männer als „Chad“ (Idealtyp) bis hin zum „Subhuman“ einsortiert werden. Wer dem Ideal nicht entspricht, wird zur Zielscheibe von Spott – oder zum Fall für drastische Ratschläge.
Medizin als Mittel zur Männlichkeit
Die Community propagiert Selbstoptimierung als den Weg zum „Erfolg bei Frauen“ und zu gesellschaftlicher Anerkennung. Daraus entsteht ein Sog hin zu medizinischer Selbstveränderung: Neben harmlosen Tipps wie Bartpflege und Training finden sich aber auch Anleitungen zu „Mewing", „Bonesmashing" (gezieltes Schlagen auf die Gesichtsknochen zur Formveränderung) und teuren Operationen wie Beinverlängerung oder Kieferchirurgie. Die Verfahren seien oft invasiv und gesundheitlich riskant – aber werden als einziger Ausweg aus der angeblichen „Subhumanen“ Zone angepriesen.
Die Autor:innen beobachteten eine paradoxe Dynamik: Medizinische Eingriffe werden einerseits als Weg zu mehr Männlichkeit stilisiert, andererseits als unnatürlich und „zu weiblich“ diffamiert, wenn sie zu auffällig sind. Diese Gratwanderung zwischen Aufwertung und Stigmatisierung zehre schließlich am Selbstbild der Nutzer, so die Autoren weiter.
Maskuline Demoralisierung: Wenn Hilfe in Hass kippt
Die ursprünglich als Hilfe gedachte Plattform entwickelt sich zum Ort systematischer „maskuliner Demoralisierung“. Wer nicht ins Idealbild passe, werde öffentlich entwertet – bis hin zu Kommentaren wie „Du solltest dich erhängen“ oder „Es ist vorbei für dich“. Auch Nutzer, die selbst angegriffen wurden, greifen andere an – ein toxischer Kreislauf aus Abwertung, psychischem Druck und Selbsthass. Suizid werde nicht tabuisiert, sondern teilweise aktiv propagiert.
Gerade junge Männer, die an ihrem Aussehen oder gesellschaftlicher Teilhabe zweifeln, können in diesen Onlineforen tief verunsichert werden. Die Studienautoren fordern daher, „Looksmaxxing" als ernstzunehmendes Gesundheits- und Gesellschaftsproblem zu betrachten – und warnen vor den psychologischen und körperlichen Schäden, die durch diese Form digitaler Selbstoptimierung entstehen können.
Fazit: Gefährlicher Schönheitswahn in der Männerwelt
Die Arbeit von Halpin et al. zeige, wie tief patriarchale Ideale in Onlinekulturen wie der sogenannten „Manosphere" verankert seien – und wie sie nicht nur Frauen, sondern auch Männer massiv schädigen. Unter dem Deckmantel der Selbstverbesserung förderten diese Communities ein menschenverachtendes Idealbild, das reale Männer mit realen Unsicherheiten zerstört, statt sie zu unterstützen.
„Looksmaxxing" ist damit deutlich mehr als ein TikTok-Trend – es ist ein Ausdruck einer digitalen Gesundheitskrise im Schatten toxischer Männlichkeitsideale, wie die Autoren es abschließend benennen.
Originalpublikation: Halpin M et al., When Help Is Harm: Health, Lookism andSelf‐Improvement in the Manosphere. Sociology of Health & Illness 2025; 47: e70015




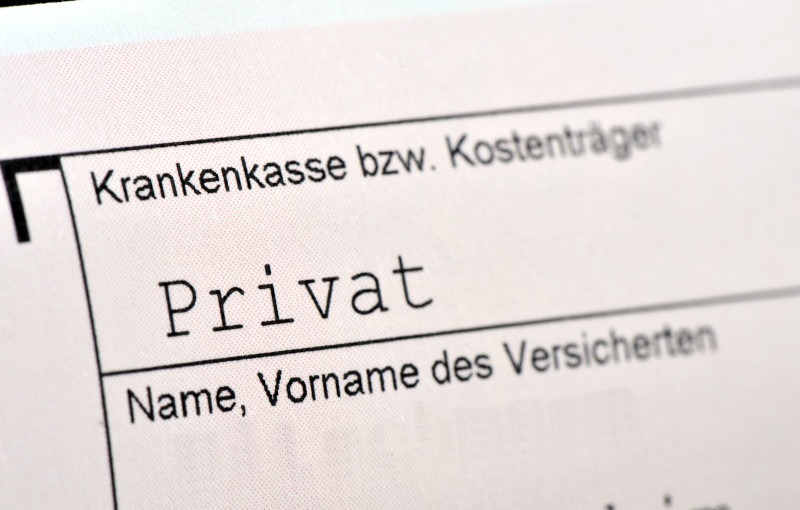

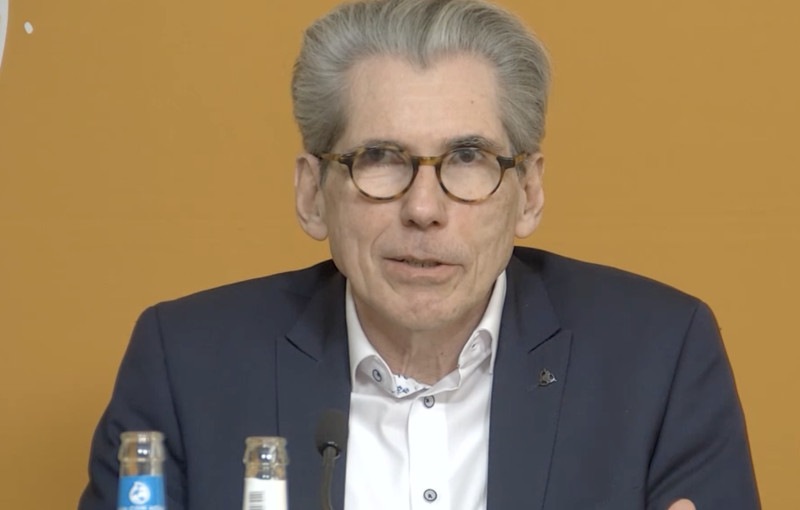

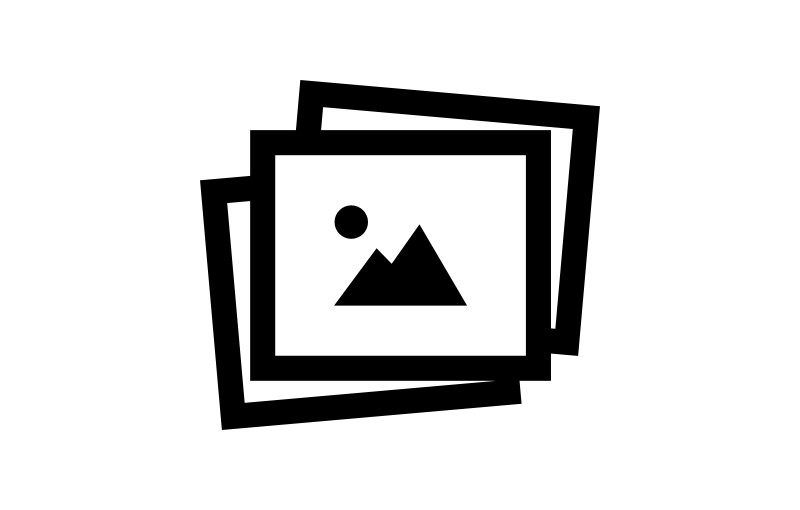Andrea Gaitanides_adobe_1481161567.jpg)

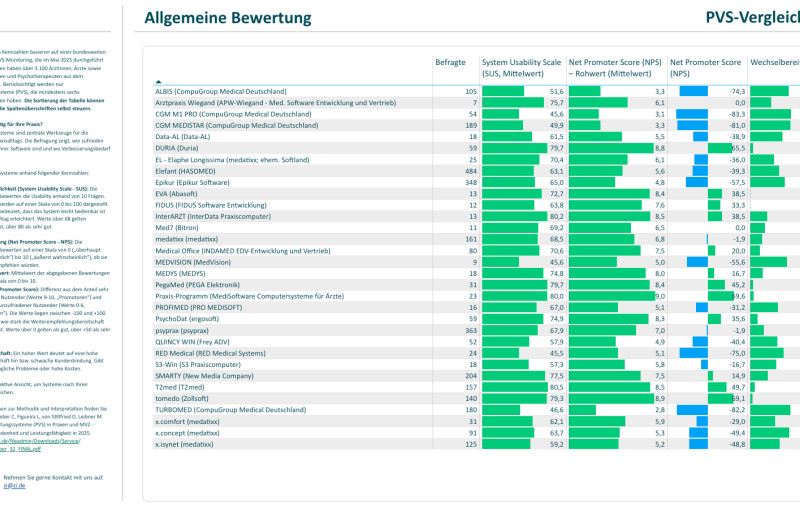
woravut_adobe_246321746.jpeg)






United States Department of Health and Human Services_888708448.png)

