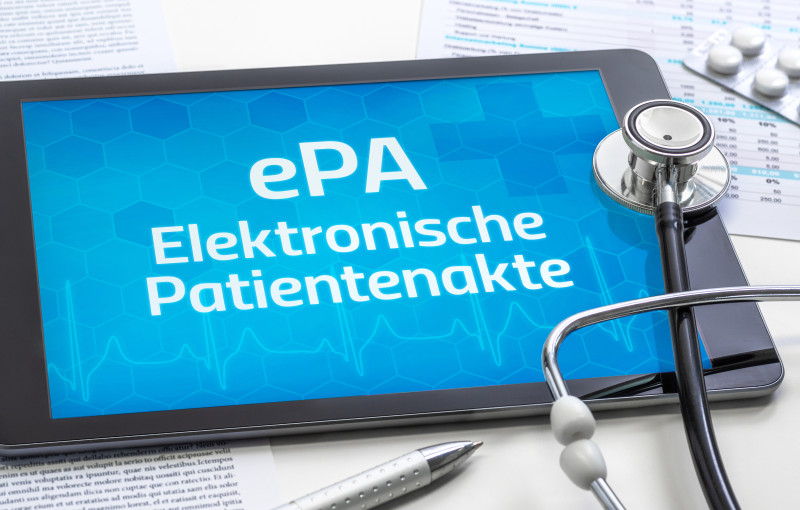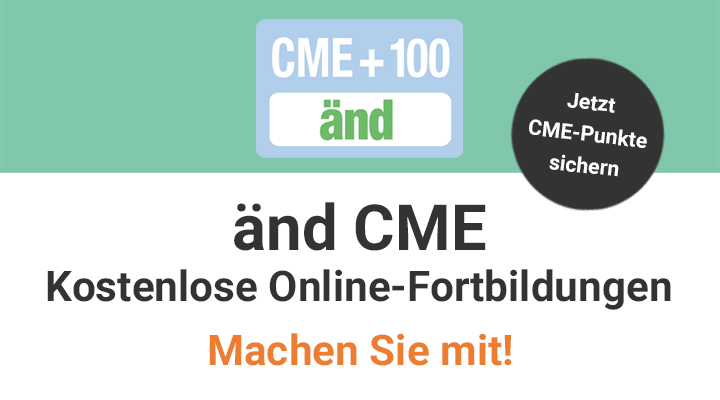„Hat nicht dem entsprochen, was ich mir vorgestellt habe“
Schon früh hat Belinda Weser ein konkretes Berufsziel vor Augen: Sie will Ärztin werden. Als sie die Approbation in der Tasche hat, zieht sie aber die Reißleine und entscheidet sich gegen die Patientenversorgung. Dem änd hat sie erzählt, warum es dazu gekommen ist.
 ©privat
Belinda Weser hat sich aufgrund der Arbeitsbedingungen dagegen entschieden, als Ärztin zu arbeiten.
©privat
Belinda Weser hat sich aufgrund der Arbeitsbedingungen dagegen entschieden, als Ärztin zu arbeiten.
Ärztin zu werden – genauer gesagt Chirurgin – war schon lange ihr Traum. Medizinische Themen hatten sie immer interessiert, sagt Belinda Weser im Gespräch mit dem änd. Erste Einblicke hatte sie beispielswiese durch Praktika bei einem niedergelassenen Chirurgen und beim Rettungsdienst gewonnen. Was sie besonders motiviert hat: die Abwechslung im Beruf. An der Chirurgie fand sie besonders den handwerklichen Aspekt spannend.
Weser, heute 26 Jahre alt, setzte also alles daran, ihr Ziel zu erreichen. Sie schaffte es ohne Wartezeit ins Medizinstudium in Dresden. Weil sie die notwendigen Eignungstests bestanden hatte, konnte sie direkt nach dem Abitur damit beginnen. Die Studienzeit hat sie zwar als schön empfunden, aber einen realistischen Einblick in den Arbeitsalltag einer Ärztin hat sie ihr nicht verschafft – trotz Praktika und Famulatur, sagt sie. Sie habe in diesen Phasen beispielsweise nur wenige Erklärungen für praktische Tätigkeiten erhalten, weil dafür einfach keine Zeit geblieben sei.
Zeitdruck und Sexismus
Dieses Zeitproblem wurde ihr umso bewusster im Praktischen Jahr (PJ), das sie an der Uniklinik Dresden absolvierte. Denn Zeit für Lehre blieb kaum. „Die Ärzte hatten wenig bis gar keine Zeit für einen, weil sie gestresst und ausgeplant waren“, schildert sie. Doch auch die Zeit für Patienten sei knapp bemessen gewesen, was sowohl bei den Patienten als auch bei ihr selbst Frust hinterlassen habe. Viel Zeit habe die Dokumentation geschluckt. Sie habe zu spüren bekommen, dass Kliniken wirtschaftlich arbeiten müssten. „Das sehe ich kritisch“, sagt sie.
Sie habe zahlreiche Überstunden gemacht, auch viele Hilfsaufgaben erledigt. Die Arbeit sei sehr anstrengend gewesen: Sie habe „gut und gerne“ pausenlos sechs bis sieben Stunden im Operationssaal gestanden und Haken gehalten, ohne etwas zu essen oder zu trinken, ohne auf die Toilette gehen zu können. Noch anstrengender, sagt sie, wäre es als Assistenärztin geworden: Dort würden aus 24-Stunden-Diensten häufig 26-Stunden-Dienste, wobei die Dienstzeit oft nicht komplett angerechnet werde. Verbesserungswürdig auch die finanziellen Rahmenbedingungen im PJ. Weser habe nur 400 Euro verdient trotz Vollzeitarbeit. „Das ist ein Witz, davon kann ich hier nicht leben.“
Auch Sexismus sei ihr oft begegnet. Wenn Weser erzählt habe, dass sie Chirurgin werden wolle, sei sie häufig gefragt worden, ob sie sich das gut überlegt habe – es sei schwer als Frau in dieser Fachrichtung, der Dienst unvereinbar mit der Familie. Dass sich dieses Bild bisher gehalten habe, zeige sich ihrer Meinung nach bei den Oberärzten und Chefärzten, die meistens Männer seien. Sie habe sich während des PJs mit vielen Ärztinnen und Ärzten unterhalten, um zu wissen, was auf sie zukommen könnte. Ein Oberarzt habe ihr gesagt: „Bei uns hat niemand eine intakte Familie.“ Das Arbeitsklima und der Umgang miteinander sei darüber hinaus häufig undankbar und rau gewesen.
Wesers Fazit: „Das hat in vielerlei Hinsicht nicht dem entsprochen, was ich mir vorgestellt habe.“ Sie habe nach sorgsamer Abwägung die Entscheidung getroffen, nach ihrer Approbation keine Weiterbildung zu beginnen, auch wenn Teile davon im ambulanten Bereich absolviert werden könnten. Im Krankenhaus sehe man schlicht seltenere Krankheitsbilder. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, sagt sie.
„Schade, das ist ein toller Job“
Sie wisse aus Gesprächen, dass viele andere Medizinstudierende ähnlich enttäuscht seien wie sie. Große Zustimmung habe sie auch erhalten, nachdem sie einen Artikel über ihre Entscheidung im Berufsnetzwerk „Linkedin“ veröffentlicht habe. Sie habe damit auf die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen aufmerksam machen wollen. Doch es hagelte auch Kritik: Einige Chefärzte hätten ihr vorgeworfen, Steuergelder verschwendet zu haben. „Die, die in Führungspositionen sind, erkennen die Probleme nicht an und würden sie auch nicht angehen“, so Weser. Das zeuge nicht von Führungsqualität.
Für sie passt das System aktuell „vorne und hinten nicht zusammen“: Einerseits gebe es große Probleme aufgrund des Ärztemangels. Andererseits gebe es eine enorme Anzahl an Studierenden, die keinen Studienplatz erhielten oder während der Ausbildung unglücklich seien. „Schade, das ist ein toller Job“, so die 26-Jährige.
Dass es so nicht weitergehen könne, zeige auch die wachsende Zahl von psychischen Erkrankungen und Suiziden bei Ärztinnen und Ärztinnen und Pflegepersonal sowie die Quote derer, die den Beruf verlassen. Dass Pflegepersonal fehle und das bestehende Personal deshalb übermäßig viel arbeite, werde öffentlich häufig thematisiert; bei Ärzten werde der Arbeitsaufwand hingegen mit dem Gehalt gerechtfertigt. Weser: „Für das, was man arbeitet, ist es nicht überragend.“
Weser nutzt ihr Wissen und ihre Erfahrung nun für eine Firma, die Praxen digitale Softwarelösungen anbietet, beispielsweise für die digitale Patientenaufnahme. Grundsätzlich kann sie sich aber auch vorstellen, doch noch eine Facharztweiterbildung zu machen. Aber nicht unter diesen Bedingungen.






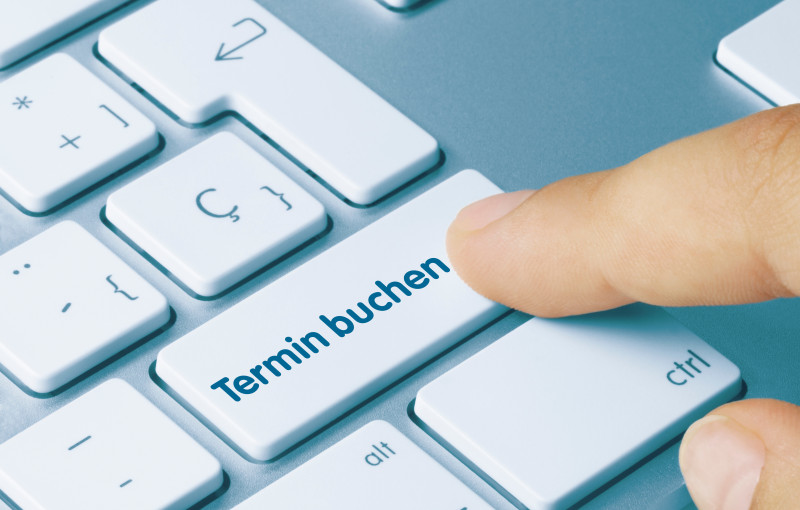


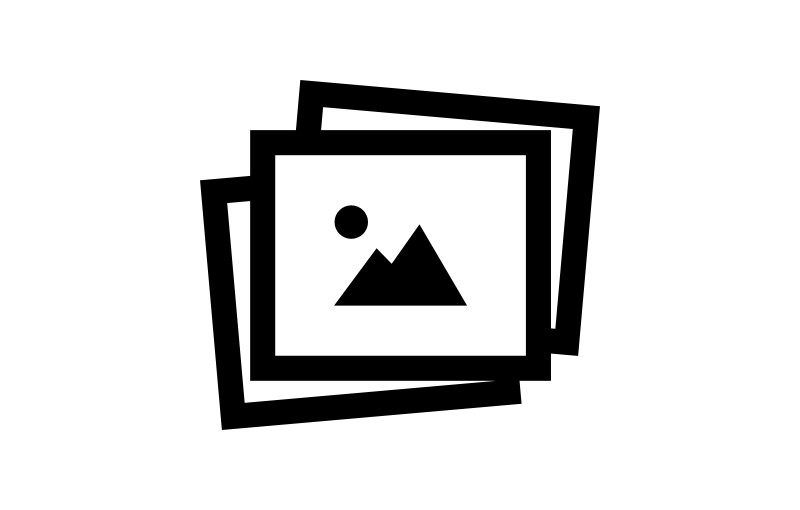Andrea Gaitanides_adobe_220647863.jpg)