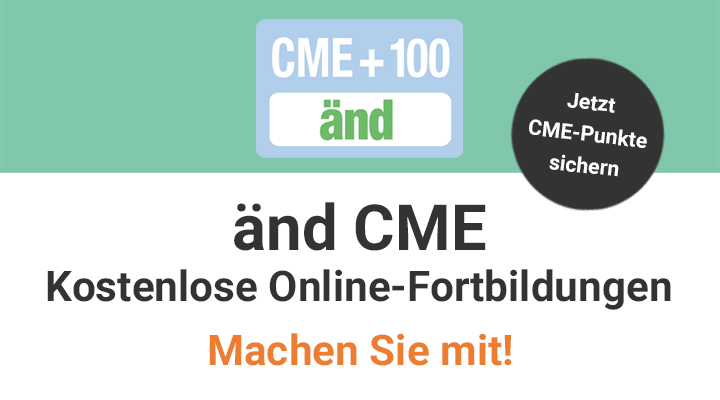„Diskussion um Investoren-MVZ auf Normalmaß zurückfahren“
Die Ampel-Koalition hat sich eine Neuregulierung der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) vorgenommen. Derzeit ist davon zwar noch nichts zu hören. Doch die Diskussion um Investoren-MVZ flammt immer wieder auf. Nun hat ein Gesundheitsökonom kritisiert, dass vertragsärztliche MVZ benachteiligt seien. Der änd wollte wissen, ob das stimmt und fragte einen Vertragsarzt, der ein großes MVZ gegründet hat: Dr. Bernhard Landers, seit September stellvertretender Vorsitzender des MVZ-Bundesverbands.
 ©Dr. Bernhard Landers
BMVZ-Vize und MVZ-Eigner Dr. Bernhard Landers mahnt eine sachliche Diskussion um MVZ an.
©Dr. Bernhard Landers
BMVZ-Vize und MVZ-Eigner Dr. Bernhard Landers mahnt eine sachliche Diskussion um MVZ an.
änd: Herr Dr. Landers, Sie haben den stellvertretenden Vorsitz im BMVZ übernommen, um die Position der vertragsärztlichen MVZ im Verband prominent zu vertreten. Was unterscheidet denn von Ärzten gegründete und betriebene MVZ von anderen, die etwa von Kliniken oder Investoren getragen werden?
Dr. Bernhard Landers: Wenn mein Unternehmen in Schieflage geraten sollte, gibt es keinen, bei dem ich eine „Nachschusspflicht“ einfordern könnte. Entscheidender Unterschied ist also an erster Stelle, dass das wirtschaftliche Risiko bei vertragsärztlichen MVZ allein beim Gesellschafter, also dem Vertragsarzt und Gründer liegt. Deshalb engagiere ich mich im BMVZ, um den „vertragsärztlichen MVZ-Gesellschaftern“ eine Stimme zu geben. Ansonsten unterscheidet uns weiter die Rekrutierung von gerade ärztlichem Personal, was sich für uns wesentlicher schwieriger gestaltet, da wir im Gegensatz zu Klinik-MVZ nicht „an der Quelle“ sitzen. Das sind natürlich ganz pauschale Annahmen, da ich mangels Hintergrundwissen nicht für die Motivationen und Ergebnisse von Klinik- oder MVZ mit Investorenbezug sprechen kann.
Und beim Patientenkontakt?
Da sehe ich keine prinzipiellen Unterschiede. Gute und weniger gute Ärzte und Praxen dürfte es in allen Strukturen einschließlich der Einzelpraxen geben. Patienten stimmen hier mit den Füßen ab und wir sehen, dass es ihnen in aller Regel eher egal ist, ob sie in einer BAG oder einem MVZ mit angestellten Ärzten sind. Auch die Trägerfrage spielt kaum eine Rolle. Patienten interessieren sich vor allem für schnelle Termine und eine gute Versorgungsqualität. MVZ, die das bieten, gibt es in allen Trägerschaften.
Der Gesundheitsökonom Schreyögg sagte kürzlich, dass es praktisch keine neuen vertragsärztlichen MVZ mehr gibt, sondern allenfalls Umwandlungen von Gemeinschaftspraxen. Können Sie das bestätigen?
Klar ja. Zwar liegt uns kein eigenes Zahlenmaterial vor, aber allein der Umstand, dass die Zahl der fachgleichen MVZ ziemlich genau der Zahl der seit 2016 neu hinzugekommenen MVZ entspricht, ist ein starkes Indiz für die These. Eine Ursache dürften tatsächliche wirtschaftliche Nachteile sein, wenn man fachübergreifend versorgt. Das ist auch in der Gesamtbetrachtung schade. Denn aufgrund der aktuellen Bedürfnisse junger Mediziner:innen ist ja die (Teilzeit-)Anstellung in kooperativen Einrichtungen bevorzugte Berufsperspektive. Dies kann ich aus eigener Erfahrung in den Rekrutierungsgesprächen nur bestätigen. Fragen nach den Arbeitsbedingungen haben einen hohen Stellenwert, das Honorar ist nur der „Hygienefaktor“. Aus diesem Grund sollten MVZ nicht generell kritisch beäugt werden, sondern vielmehr ein ausreichendes Angebot für die steigende Nachfrage dieser jungen Mediziner:innen bereitstellen. Deshalb sollten die Rahmenbedingungen für MVZ-Gründungen nicht schlecht geredet oder verschärft, sondern verbessert werden.
Inwiefern werden MVZ denn wirtschaftlich benachteiligt? Und gilt das für vertragsärztliche MVZ ganz besonders?
Fakt ist, dass die aktuellen Abrechnungsvorgaben sich in ihrer Wirkung auf MVZ von Einzelpraxen darin unterscheiden, dass dort jeder Arztfall „voll“ zählt, während in Kooperationen wie MVZ - unabhängig von der fachlichen Besetzung - nur einmal die Versichertenpauschale abgerechnet werden kann, egal wie viele Fachärzte beteiligt sind. Dies wurde 2009 im EBM eingeführt; mit der amtlichen Begründung, dass MVZ sich innerhalb der Einrichtung „massenhaft Fälle zuschustern“ würden. Folge ist bis heute eine Ungleichbehandlung, weil die verschiedenen Fachärzte des MVZ bei einem gemeinsamen Versorgungsfall zwar jeweils Leistungen erbringen, die aber – anders als bei den niedergelassenen Kollegen - eben nicht voll honoriert werden. Hier besteht Nachjustierungsbedarf, gerade bei MVZ mit Haus- und Fachärzten bei einer weiterführenden Diagnostik und Therapiekontrolle. Das betrifft alle MVZ – völlig unabhängig von ihrer Trägerschaft. Und es betrifft auch fachübergreifende BAGs.
Aber gibt es nicht, um genau dies auszugleichen, den Kooperationszuschlag?
Ja, aber … Richtig ist, dass aufgrund der beschriebenen systematischen Minderhonorierung zeitgleich der Kooperationszuschlag eingeführt wurde, der folglich einen Nachteilsausgleich und eben keinen „Zuschlag“ darstellt. Dieser Ausgleich erfolgte jedoch von Anfang an und aus Prinzip höchst unvollständig. Zusätzlich haben die meisten KVen diesen ursprünglich größenabhängigen Zuschlag inzwischen auf 20 oder gar nur 10 Prozent reduziert – das heißt: Egal wie groß ein MVZ ist, es erhält denselben Größen-Ausgleich wie jede Zweier-BAG. Je größer und fachvielfältiger ein MVZ daher ist, desto stärker sind die negativen Honorareffekte.
Schreyögg hat auch kritisiert, dass Ärzte als MVZ-Gründer und -Träger gegenüber Kliniken benachteiligt sind. Sehen Sie das auch so?
Ich habe den Beitrag über Professor Schreyöggs Äußerungen mit Interesse gelesen und kann seinen Aussagen überwiegend zustimmen. Unterschiede zum Beispiel beim Personalrecruiting und dem Zugang zu Investitionsmitteln liegen auf der Hand. Umgekehrt sind Ärzte als Träger von MVZ gegenüber dem Tanker „Klinik“ oftmals im Vorteil, was Entscheidungenfindungen angeht. Gerade diese Unterschiede sind meines Erachtens ein positiver Aspekt unserer Versorgungs- beziehungsweise Anbietervielfalt. Es gilt, jeweils von den Besten zu lernen und auch bereit zu Veränderungen zu sein, statt eine Meisterschaft im „Beharrungsvermögen“ auszutragen.
Es gibt ja auch eine große Diskussion um Investoren-MVZ. Wie hat sich denn deren Anteil nach den Erkenntnissen des BMVZ entwickelt?
Von einem sehr niedrigen Level ausgehend vergleichsweise dynamisch. Bedeutet, dass deren Anteil schneller steigt, als die Zahl aller MVZ. Trotzdem reden wir über alle Fächer inklusive der Zahnmedizin über einen Anteil von ein bis zwei Prozent der Versorgung. Von diesen Zahlen ausgehend sollte die Diskussion um die nicht-ärztlichen MVZ-Träger auf ein normales Maß reduziert werden und der Fokus auf die wirklich wichtigen Fragestellungen einer zukunftsfähigen Versorgung gerichtet sein. Zumal auch das vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebene Rechtsgutachten zu Stand und Weiterentwicklung der gesetzlichen Regelungen zu MVZ keine Notwendigkeit weiterer gesetzlicher Maßnahmen erkennt. Identifiziert wird in diesem Gutachten vom Winter 2019/2020 aber ein Handlungsbedarf zur erleichterten Übergabe von MVZ-Geschäftsanteilen an Ärzte im MVZ, was gerade für vertragsärztliche MVZ wie ich sie habe, eine große Rolle spielt.
Wie sieht denn die BMVZ-Mitgliederstruktur nach Trägeranteilen aus?
Wir erfassen das ehrlich gesagt nicht genau, da die Trennung nach Träger einfach kein gutes Kriterium ist – schon gar nicht, um die Qualität eines MVZ zu bewerten. Vereinszweck ist die Förderung der ambulant-kooperativen Versorgung durch Weiterentwicklung fachgruppen- und sektorenübergreifender sowie interdisziplinärer Strukturen. Wer das mitträgt, ist im Verband willkommen. Es gibt unter den Mitgliedern alle Trägerschaften. Tatsächlich ist aber der Anteil arztgeführter MVZ im BMVZ geringer als insgesamt unter den MVZ. Die Klinik-MVZ sind entsprechend überproportional vertreten … Manchmal denke ich, dass vielen BAG- und MVZ-Kollegen gar nicht klar ist, wie wichtig es ist, eine Stimme in Berlin zu haben, die gezielt für die Belange kooperativer Versorger trommelt. Hier macht der BMVZ im Übrigen auch keinen Unterschied zwischen MVZ oder BAG. Die organisatorischen Herausforderungen sind ja oft auch sehr ähnlich.
Sie selbst sind Arzt und MVZ-Gründer und -Träger. Auf welche Schwierigkeiten sind Sie gestoßen, vor denen Kliniken und Investoren nicht stehen?
Die größte Herausforderung war der Aufbau einer Verwaltung, die sich um die Felder Personal, Recht, Finanzen und IT kümmert. Auch in Bezug auf die Investitionstätigkeit stehen Kliniken naturgemäß meist besser dar. In diesen Bereichen sind Kliniken klar im Vorteil, während ich aus meiner vertragsärztlichen Tätigkeit die Erfahrungen der ambulanten Leistungserbringung und -abrechnung und Praxisorganisation habe. Was mich heute aber nach wie vor begleitet, ist die Tatsache, dass MVZ in der Öffentlichkeit unter „Generalverdacht“ gestellt werden, statt die Vorteile einer Versorgung unter einem Dach hervor zu stellen. Denn ein Patient wünscht sich eine gute Versorgung und ihm ist nicht in erster Linie wichtig, ob der Arzt selbständig ist oder in einem MVZ arbeitet.
Und warum haben Sie ein MVZ gegründet statt bei Ihrer (Gemeinschafts-)Praxis zu bleiben?
Zwei Hauptgründe waren ausschlaggebend: In einer Gemeinschaftspraxis ist es wie in einer Beziehung, es gibt Höhen und Tiefen. Und wir waren – bei einem Mitgesellschafter auch aus Altersgründen – am Ende unserer Beziehung angelangt. Das führt uns zum zweiten Grund: Ich wollte meine Vorstellung einer guten, kooperativen Patientenversorgung, bei der zum Beispiel auch angestellte Ärzte sich gleichberechtigt einbringen können, gerne verwirklichen. Als Lehrbeauftragter der Uni Bonn und als Prüfungsarzt bin ich schon früh mit dem Umstand konfrontiert worden, dass für einen Großteil der jungen Ärzt:innen eine Einzelpraxis als Auslaufmodell gilt.
Welche Rolle hat für Sie das unternehmerische Risiko gespielt? Was macht das für einen Unterschied, ob ich als Arzt eine Praxis oder ein MVZ gründe und führe?
Bei dieser Frage ist es gleich, ob sie Arzt oder Handwerker oder Jurist sind. Für jeden dieser Berufe gilt die Frage: Wieviel unternehmerisches Risiko bin ich bereit zu tragen? Nur für mich oder auch für viele Mitarbeiter? Die Antwort muss jeder für sich finden. Ich bin anscheinend risikobereiter gewesen, weil ich an eine Sache – die der MVZ und der damit verbundenen Vorteile – glaube.
Tatsächlich hat man von Praxispleiten noch nichts gehört, während gerade wieder ein großes MVZ Insolvenz angemeldet hat. Schreyögg führt das darauf zurück, dass angestellte Ärzte weniger produktiv seien als selbstständige, an denen sich die Vergütung ausrichtet. Teilen Sie diese Einschätzung?
Da möchte ich widersprechen. Nur, was wir Ärzte während unserer Ausbildung nicht beigebracht bekommen, sind betriebswirtschaftliche Aspekte. Erst während meiner Selbstständigkeit musste ich mich intensiver mit Begriffen wie Deckungsbeitrag, EBITDA, Wirtschafts- und Liquiditätsplanung beschäftigen. Wenn Sie das betriebswirtschaftliche Wissen haben, dürfte auch mit angestellten Ärzten eine Insolvenz ausgeschlossen sein.
Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund für diese MVZ-Pleiten?
Es gibt eigentlich nur zwei Hauptgründe: negatives Betriebsergebnis, also zu hohe Ausgaben, oder fehlende Nachbesetzung offener Stellen, beides eine Form von Missmanagement und/oder fehlender Erfahrung. Dadurch, dass das Gesundheitswesen wenig konjunkturabhängig und ein Rückgang von Erkrankungen nicht zu erwarten ist, gibt es immer genügend „Nachfrage“ respektive Bedarf an medizinischer und pflegerischer Versorgung.
Noch einmal zu Schreyögg: Er hat Vergütungszuschläge für fachgruppenübergreifende MVZ gefordert. Teilen Sie diese Forderung?
Das Wort Zuschlag suggeriert, das eine bestimmte Gruppe politisch gewollt ein Mehr bekommt. Da würden wir nur die Büchse der Pandora öffnen. Was ich mir vielmehr wünsche, ist eine EBM-Reform, die die aktuellen Erfahrungen und zukünftigen Herausforderungen an eine stärker fach- und sektorübergreifende Behandlung entsprechend darstellt. Dabei muss es natürlich darum gehen, die ganzen Vergütungsnachteile für Kooperationen, insbesondere für fachübergreifende, abzubauen. Der Behandlungsfall, definiert als Summe aller Arztkontakte eines Patienten durch sämtliche Ärzte einer Praxis/MVZ, ist die Ursache der Unwirtschaftlichkeit der kooperativen Leistungserbringung. Die Behandlungsfallorientierung des Systems muss also abgelöst werden. Der BMVZ schlägt hier den Wechsel auf den Arztgruppenfall vor – dadurch würden Zuschlagssystematiken – außer bei fachgleichen Strukturen – weitgehen überflüssig. Im stationären Sektor hat man ja auch erkannt, dass die Zeit der DRG abgelaufen ist. Aber zuvor muss eine Bereitschaft geschaffen werden, „alte Zöpfe abzuschneiden“.
In welchem Rahmen und Zeitraum sollte das passieren?
Besser gestern als heute! Eine moderne Leistungsvergütung sollte zudem wie auch im stationären Bereich den Aspekt der Ergebnisqualität mit einbeziehen. Ich spreche hier aus meiner Erfahrung als Diabetologe. Auch wären sogenannte „Hybrid-DRG“, also gemeinsame Vergütungsbestandteile innerhalb einer interdisziplinären, sektorübergreifenden Versorgung, einschließlich Pflege bei bestimmten Krankheitsbildern zukunftsweisend. Es bedarf nur den Mut, diese Modelle einfach endlich mal aus der Schublade hervor zu holen.
Ein Plan im Rahmen der lange erwarteten Versorgungsstärkungsgesetze ist, dass künftig Kommunen leichter MVZ gründen können sollen. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Beitrag zur Trägerpluralität oder unnütz?
Das ist eher nur ein – wenn auch gut gemeinter – Vorschlag, der aber nicht die tatsächlichen Herausforderungen löst. Grundsätzlich ist es aber richtig, dass viele verschiedenartige Trägerschaften ermöglicht werden. Als Verband wünschten wir uns sogar, der Gesetzgeber wäre hier noch mutiger. Sie fragten mich nach Gründen von Insolvenzen. Ich stelle Ihnen hier eine Gegenfrage: Wie soll eine Kommune über ein medizinisches und betriebswirtschaftliches Know-How für ein MVZ-Management verfügen? Ich befürchte, dass am Ende die Kommunen auch hier Defizite ausgleichen müssen. Oder anders gefragt: Will man Trägerpluralität bei MVZ nur dann, wenn es in den politischen Rahmen passt? Insgesamt glaube ich nicht, dass infolge der geplanten Änderung plötzlich zahlreiche kommunale MVZ neu entstehen.
Ok. Trägerpluralität ist also aus BMVZ-Sicht eine Stellschraube, Ungerechtigkeiten zwischen unterschiedlichen Trägern sind dagegen nicht das große Problem, oder? Was müsste dann beim Gesetzgeber in Sachen MVZ zuoberst auf die Agenda?
Ein Bewusstsein für den Mehrwert kooperativer Strukturen. Trägerneutral. Die Zusammenführung von Ressourcen und Kompetenzen ist einfach gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich und auch für den einzelnen Patienten sinnvoll. Wir als BMVZ verlangen nicht, dass einzelne Stellschrauben bedient werden. Die Politik soll den Blick von Einzelthemen hin in die Zukunft richten. Es ist nicht sinnvoll, Partikularinteressen von Parteien, Akteuren etc. zu bedienen, sondern das deutsche Gesundheitswesen, auch unter den föderalistischen Herausforderungen, demografiefest und finanzierbar zu gestalten. Der BMVZ kann aufgrund seiner bunten Mitgliederstruktur und deren Expertise hierzu vielfältige Beiträge leisten.





mnirat_adobe_26369007.jpg)






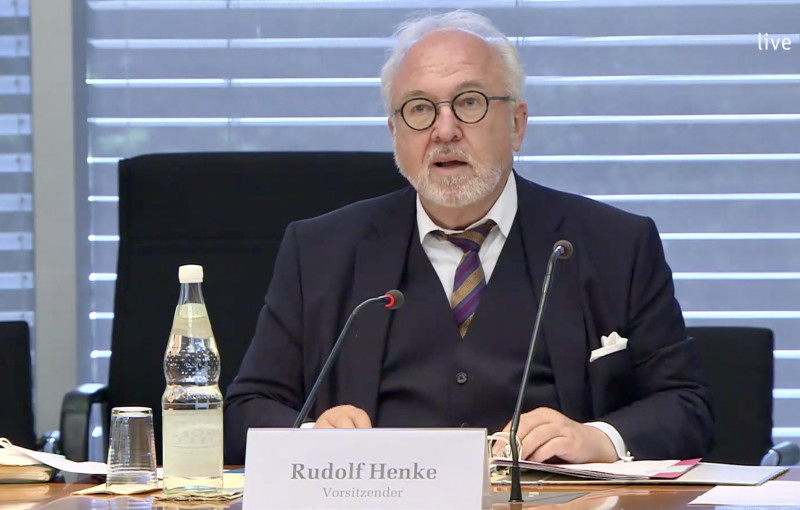


_2065518678.jpeg)