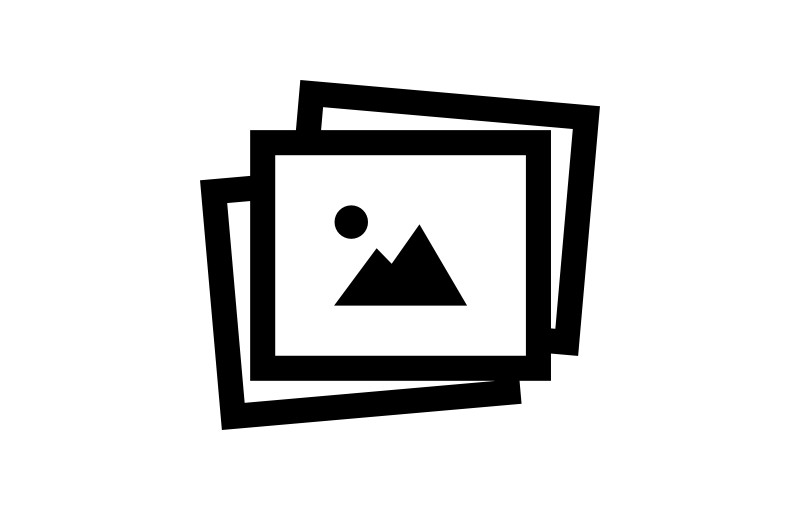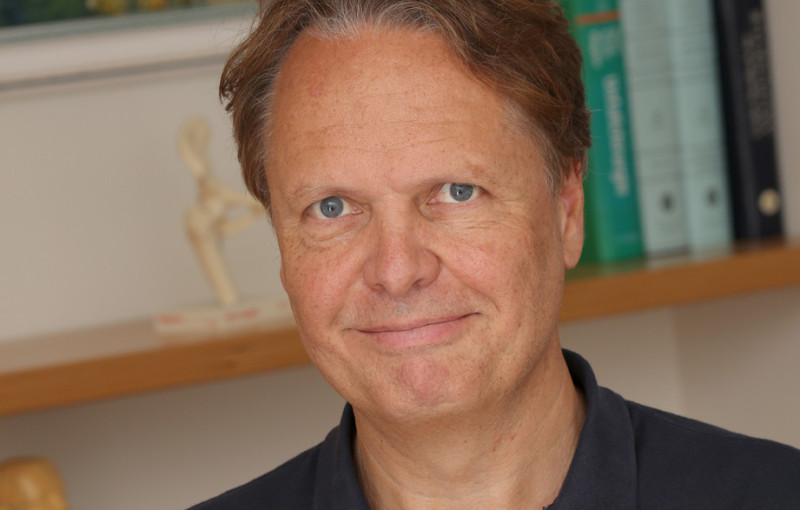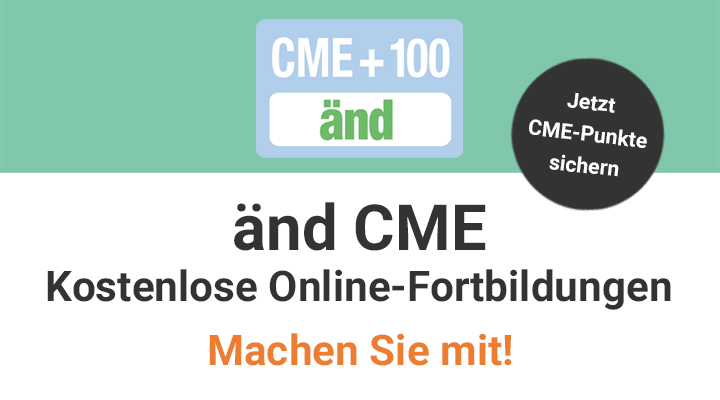Charité richtet zentrales interdisziplinäres Nieren-Transplantationszentrum ein
Im September 2024 eröffnet am Virchow-Klinikum der Berliner Charité das neue zentrale Nieren-Transplantationszentrum. Prof. Thorsten Schlomm, Direktor der Klinik für Urologie an der Charité, sieht das Klinikum mit diesem neuen Zentrum auf dem richtigen Weg zu einer effizienten, interdisziplinären Transplantationsmedizin am Standort Berlin, wie er im Interview mit dem Ärztenachrichtendienst verrät.
Herr Prof. Schlomm, was ist mit Blick auf Nierentransplantationen ab September an der Charité geplant?
Als ich im Februar 2018 als Leiter der Urologie an die Charité gekommen bin, fiel mir sofort auf, dass wir als Urologinnen und Urologen drei Standorte zu versorgen hatten und bis dato noch haben. Am Standort Mitte bieten wir die komplette chirurgische Versorgung an, ebenso in Steglitz. Hinzu kommen die Nierentransplantationen, die wir bisher noch am Klinikum Mitte durchgeführt haben. Die Viszeral-Chirurgen wiederum betrieben bislang am Virchow-Klinikum ihr eigenes Nierentransplantationsprogramm, jeweils zusammen mit der Nephrologie, die auch an zwei Standorten tätig sein musste. Zwei getrennte Nierentransplantationszentren sind natürlich wenig sinnvoll. Es müssen zwei Patienten- und Wartelisten geführt und auch die Kapazitäten müssen doppelt vorgehalten werden. Eine solche Doppelvorhaltung bringt ebenfalls mit sich, dass es an jedem Standort ein anderes Team von Operateuren und Nephrologen gibt und dadurch auch methodisch andere Standards gelten. Zuletzt müssen auch die Kosten doppelt verrechnet werden, was eine doppelte Haushaltsführung bedingt. Das ist mit nur einem Zentrum jetzt sehr viel einfacher. Schon in meine Berufungsvereinbarung hatte ich schreiben lassen, dass wir in einem 3-Schritt-Modell auf ein Ein-Standort-Modell zuarbeiten – und das Ganze innerhalb von 5 Jahren umsetzen wollen. Durch Corona hat es sich jetzt leider auf sechseinhalb Jahre verlängert, aber ab September sind wir endlich dort, wo wir hinwollen. Die Schaffung des zentralen Transplantationszentrums ist daher ein ganz klarer, gewollter Prozess.
Eine Zusammenlegung von Zentren wird häufig mit einer Verschlechterung assoziiert, sowohl versorgungstechnisch, aufgrund geringer werdender Kapazitäten, als auch personell. Ist die Zentralisierung der Nierentransplantation an der Charité aus Ihrer Sicht überwiegend von Vorteil oder gibt es auch Nachteile?
Ganz im Gegenteil, Herr Dr. Mau, die Kapazitäten werden steigen. Die Chirurgen mussten bislang 30 Dienste pro Monat abbilden und auch wir mussten 30 Dienste pro Monat abbilden, also 60. Zudem mussten von der Nephrologie zwei Transplantationsstationen betreut werden. Und das kann jetzt pro Klinik reduziert werden. Zusätzlich können wir nun stärker interdisziplinär bei Komplikationen, nephrologischen, gefäßchirurgischen oder urologischen Herausforderungen zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, ein Qualitätssprung für das Zentrum. Was letztlich die Patientinnen und Patienten angeht, denke ich, dass die Menschen – wenn wir alles richtig gemacht haben – diese Umstrukturierung gar nicht bemerken werden. Für sie bleiben die Anlaufstellen die gleichen, d. h., die Menschen können auch weiterhin an den Standort Mitte in die Poliklinik gehen, so wie sie es gewohnt sind. Wer dann nierentransplantiert wird, fährt ein paar Kilometer weiter ins Transplantationszentrum. Der Ort ist für die Patienten oft nicht entscheidend, aber sie wollen von Spezialist:innen behandelt werden und das ist ebenso am neuen Zentrum unverändert möglich.
Warum wird und wurde im Vorfeld der Erweiterung des Nierentransplantationszentrums am Campus Virchow-Klinikum so wenig öffentlich darüber kommuniziert?
Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe dafür. Der pragmatische Grund ist, wir sind natürlich in der Zeitplanung immer auf Dinge und deren Gelingen angewiesen, die wir selbst nicht steuern können. Da hängt vieles mit vielem zusammen, z. B., ob die OPs fertig sind, ob die Station frei ist, usw. Das heißt, sie müssen sich das wie eine Reihe Dominosteine vorstellen. Da braucht ein Schritt den Vorangegangenen, um ablaufen zu können. Wir können erst aus Mitte umziehen, wenn alle Voraussetzungen für die interdisziplinäre Nierentransplantation im Virchow-Klinikum fertiggestellt sind. Das gilt ja nicht nur für die Urologie, sondern auch die Nephrologie und Viszeralchirurgie. Alles vor Ort muss funktionieren und in Betrieb gehen können. Terminverschiebungen sind häufig schlecht nach außen zu kommunizieren. Aktuell geplant ist ein Start im September 2024.
Wird die Urologie der Charité auch weiterhin am neuen Transplantationszentrum involviert sein?
Wir werden uns am neuen Zentrum – genauso wie die Chirurgie und Nephrologie auch – mit einem Team beteiligen. Es ist eine Oberärztin (Frau Dr. Lichy) vor Ort eingeteilt, die den Campus oberärztlich und auch die Nierentransplantation verantwortlich urologisch betreuen wird. Hinzu kommt natürlich weitere Unterstützung durch wechselnde Teams, z.B. für Transplantationen in der Nacht.
Betrifft die Zentralisierung ebenso die Nierenresektionen im Rahmen der Therapie des Nierenzellkarzinoms oder bleibt diese OP in der Urologie Charité Mitte unverändert bestehen?
In Steglitz haben wir unsere Krebschirurgie weiterentwickelt und ein hochmodernes Haus mit neuen OP-Sälen ausgerüstet, mit neuen Kapazitäten auch in der robotisch assistierten Chirurgie. Aber alle Nierentransplantations- assoziierte Operationen finden dann am Virchow-Klinikum statt, z.B. Zystennierenentfernung oder Transplantatnephrektomien. Das heißt, wir haben dort eigene OPs und eigene Betten. Auch die urologische Nachbetreuung der transplantierten Patienten wird am Virchow-Klinikum durchgeführt. Die Patientinnen und Patienten, die am Virchow-Klinikum transplantiert wurden, müssen dann nicht mehr, wie derzeit der Fall, nach Steglitz für die Doppel-J-Entfernung und danach weiter an den Standort Mitte für die Weiterbetreuung durch die Nephrologie. Das ist dann schon alles an einem Ort, d. h., Nierentransplantation und alles, was damit zusammenhängt, wird zentral am neuen Transplantationszentrum der Virchow-Kliniken gemacht.
Die Zuweisung von den Niedergelassenen erfolgt an die Urologie der Charité? Oder wenn es sich um Transplantationspatienten handelt, direkt an das Transplantationszentrum? Wie ist das organisiert?
Die Zuweisungen an die Urologie laufen weiter, wie gehabt. Auch am Standort Mitte findet die Beratung statt, und wer schließlich urologisch operiert werden muss, erhält einen OP-Termin am Charité Benjamin-Franklin Campus in Steglitz. Alle Nierentransplantationen gehen hingegen zum Virchow-Campus an das neue interdisziplinäre Transplantationszentrum.
Wie viele Patientinnen und Patienten wird das neue Zentrum jährlich operieren können?
2023 haben wir im Zentrum 220 Nierentransplantationen durchgeführt. Davon, glaube ich, waren 70 bis 80 Lebendspenden. Mit diesen Größenordnungen sind wir in Deutschland mit Abstand das größte Zentrum. Wir rechnen durch die Zentralisierung am Virchow-Klinikum eher noch mit einem Aufwuchs der Zahlen, weil wir einfach deutlich mehr Kapazitäten haben werden.
Sehen Sie durch die neue Zentrumsbildung eine Schwächung der Urologie an der Charité?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Nierentransplantationen sind ganz klar ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. Persönlich bin ich darauf auch sehr stolz, denn die Nierentransplantation gehört zu einer urologischen Vollversorgung dazu. Mit Blick auf eine solche Vollversorgung, so glaube ich, gibt es ohnehin nur noch sehr wenige Zentren in Deutschland, welche die komplette Urologie anbieten können – und dabei natürlich trotzdem auch Schwerpunkte bilden müssen. Unsere Schwerpunkte richten wir an der Charité in drei Kategorien aus: Onkologie, Nierentransplantation und nicht zuletzt die Urogynäkologie. Das sind gleichzeitig ebenso unsere Alleinstellungsmerkmale in der Region. Wir treten nicht in Konkurrenz mit den anderen regionalen Häusern um Standardeingriffe. Zusätzlich wird aber auch der Standort Mitte weiterhin 24/7 notfallmäßig durch uns versorgt werden, inklusive der Möglichkeit von Not-OPs. Der Spagat zwischen der früher viel gescholtenen Spezialisierung im Department Model und gleichzeitigem Ausbau eines maximalen Spektrums ist uns gelungen. Da bin ich sehr stolz drauf.
Prof. Dr. med. Thorsten Schlomm ist Direktor der Klinik für Urologie an der Charité Berlin. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich der Uroonkologie. Darüber hinaus setzt er sich stark für interdisziplinäre Behandlungsansätze ein, beispielsweise im Bereich Urogynäkologie oder auch am neuen Transplantationszentrum der Charité an der Virchow-Klinik.


_1034052805.jpeg)


 SLÄK_1062975209.jpg)







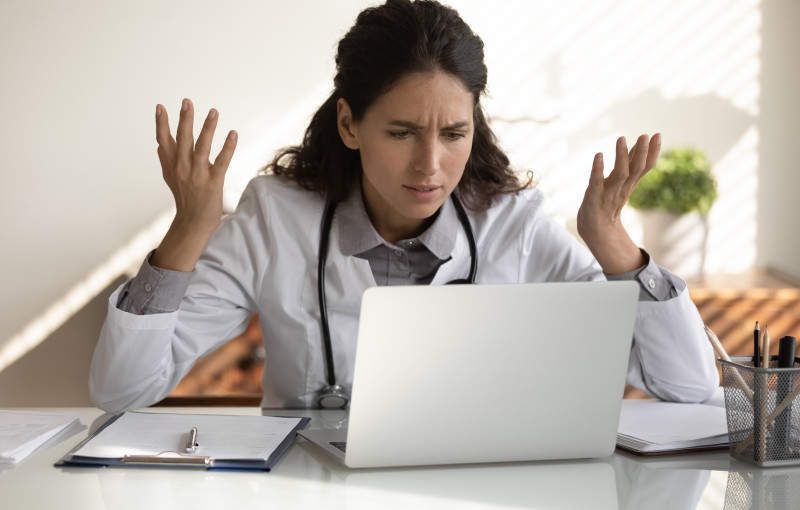

_1202739061.jpeg)