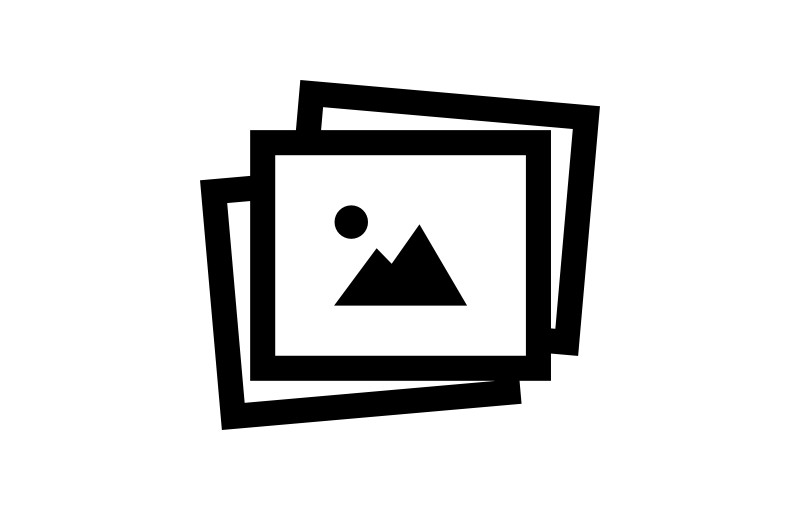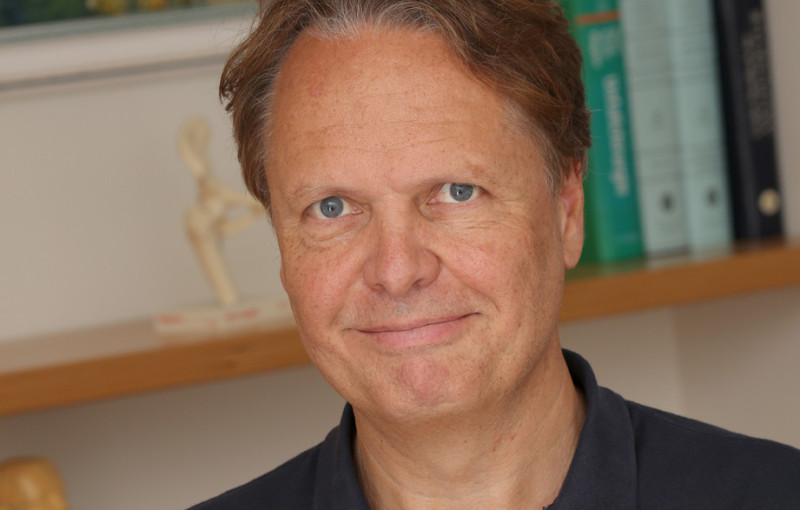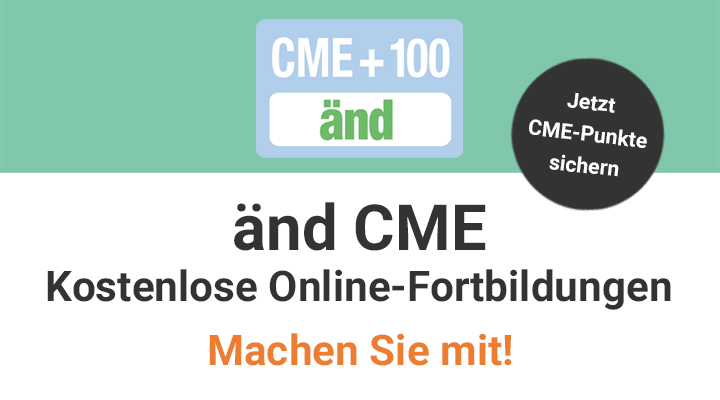Die großen Pläne und gebrochenen Versprechen der Ampel im Gesundheitswesen
Die Ampelregierung hatte große Pläne für das Gesundheitswesen – von der Digitalisierung über Reformen der ambulanten und stationären Versorgung bis hin zu einem barrierefreien und zukunftssicheren Gesundheitssystem. Doch zwischen ambitionierten Gesetzesentwürfen, politischen Streitigkeiten und einem letztlich zerbrochenen Regierungsbündnis zeigt sich ein durchwachsenes Bild: Einige Meilensteine wie die Einführung des E-Rezepts wurden erreicht, während andere Vorhaben wie die Notfallreform oder die Stärkung der ambulanten Versorgung auf halber Strecke stecken blieben. Der änd hat in einem Rückblick das Erreichte mit den Versprechen im Koalitionsvertrag abgeglichen.
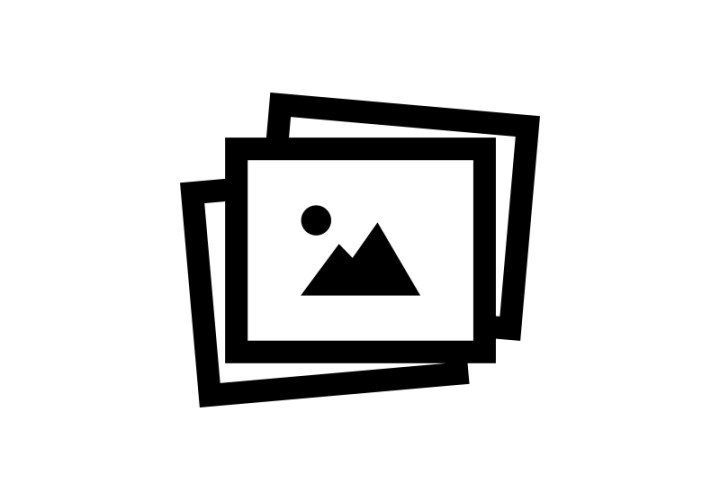 ©Screenshot änd
„Wir wollen einen Aufbruch in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik“, beteuerten die SPD, die FDP und die Grünen im Koalitionsvertrag.
©Screenshot änd
„Wir wollen einen Aufbruch in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik“, beteuerten die SPD, die FDP und die Grünen im Koalitionsvertrag.
Digitalisierung
Am meisten konnte das Bundesgesundheitsministerium im Bereich der Digitalisierung vorantreiben. Mit dem Digitalgesetz (DigiG) und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) hat die Ampelkoalition einen großen Teil der im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen auf den Weg gebracht. Das E-Rezept, das wie die elektronische Patientenakte (ePA) explizit im Koalitionsvertrag Erwähnung fand, wurde bereits vor einem Jahr verpflichtend eingeführt und gehört inzwischen zum Standard. Die Einführung einer ePA mit Opt-out-Mechanismus steht unmittelbar bevor: Am 15. Januar startet der Testbetrieb in drei Testregionen, und der bundesweite Rollout ist für Mitte Februar geplant. Ob dieser Zeitplan jedoch eingehalten wird, bleibt fraglich.
Nicht alles, was sich die Ampel im Bereich der Digitalisierung vorgenommen hat, konnte umgesetzt werden. So sollten beispielsweise alle Akteure des Gesundheitswesens „beschleunigt“ an die Telematikinfrastruktur (TI) angebunden werden. Dies ist bis heute nicht vollständig gelungen. Pflegeeinrichtungen etwa sind nach wie vor nicht an die TI angebunden – dies soll sich bis zum 1. Juli 2025 ändern.
Der Plan, die Gematik zu einer digitalen Gesundheitsagentur auszubauen, scheiterte auf den letzten Metern. Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde im Juli 2024 vom Kabinett beschlossen und Ende September im Bundestag debattiert. Aufgrund des Koalitionsbruchs kam es jedoch nicht mehr zu einer zweiten oder dritten Lesung.
Ambulante Versorgung
Im Bereich der ambulanten Versorgung konnten kaum Fortschritte erzielt werden. Dies lag nicht nur am Scheitern der Ampelkoalition und des Gesundheitsversorgungsverbesserungsgesetzes (GVSG). Zu Beginn der Legislaturperiode hatten die Koalitionäre ambitionierte Pläne: Sie wollten multiprofessionelle, integrierte Gesundheits- und Notfallzentren etablieren, niederschwellige Gesundheitsangebote wie Gesundheitskioske einführen, Gesundheitsregionen stärker fördern, die Gründung kommunal getragener Medizinischer Versorgungszentren erleichtern und im ländlichen Raum Gemeindeschwestern sowie Gesundheitslotsen einsetzen. Keiner dieser Punkte fand letztlich Eingang in den offiziellen Referentenentwurf.
Die Entbudgetierung der ärztlichen Honorare im hausärztlichen Bereich, auf die sich die bereits zerstrittenen Koalitionäre doch noch verständigen konnten und die im Rahmen des GVSG kommen sollte, fiel schließlich dem Regierungsbruch zum Opfer.
Die Pläne, die ambulante Bedarfs- und stationäre Krankenhausplanung gemeinsam mit den Ländern zu einer sektorenübergreifenden Versorgungsplanung weiterzuentwickeln, sind nicht einmal angegangen worden.
Die einzige Maßnahme, die in diesem Unterkapitel angekündigt war und dann tatsächlich auf den Weg gebracht werden konnte, war die sektorengleiche Vergütung durch sogenannte Hybrid-DRG. Damit sollte die Ambulantisierung vorangetrieben werden. Sie starteten zum 1. Januar 2024 mit rund 250 Prozeduren aus fünf Leistungsbereichen, und stehen seitdem anhaltend in der Kritik einiger Fachverbände. Die Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung für 2025 bringt zwar erweiterte Leistungskataloge und höhere Fallpauschalen. Ein ungelöstes Problem bleiben nach wie vor Sachkosten (änd berichtete).
Stationäre Versorgung
Neben den Digitalisierungsgesetzen war die Krankenhausstrukturreform das wichtigste Vorhaben des Bundesgesundheitsministeriums. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rang rund zwei Jahre mit den Bundesländern um die Details. Die Reform stand bis zum Schluss auf der Kippe und wurde buchstäblich in letzter Sekunde mit knapper Mehrheit im Bundesrat verabschiedet.
Künftig soll die bisherige fallpauschalbasierte Vergütung grundlegend überarbeitet werden: 60 Prozent der Vergütung sollen allein für das Vorhalten bestimmter Angebote gezahlt werden. Dies soll den Anreiz zu unnötigen Eingriffen beseitigen. Grundlage der Finanzierung durch die Krankenkassen werden neue Leistungsgruppen sein. Die geplante Öffnung kleiner Krankenhäuser für die ambulante fachärztliche Versorgung sorgte jedoch für heftige Kritik seitens der niedergelassenen Ärzteschaft.
Das Gesetz trat Mitte Dezember 2024 in Kraft, und die Neuerungen sollen schrittweise bis Ende 2026 umgesetzt werden. Bis dahin haben die Länder Zeit, ihren Kliniken Leistungsgruppen zuzuweisen.
Notfallversorgung und Rettungsdienst
Neben der Krankenhausstruktur sollten gemäß Koalitionsvertrag auch die Notfallversorgung und der Rettungsdienst reformiert werden. Integrierte Versorgungszentren sowie die Verzahnung von Rettungsleitstellen mit KV-Leitstellen und standardisierte Einschätzungssysteme fanden Eingang in einen Gesetzesentwurf, den das Kabinett im Juli 2024 verabschiedete.
Der Rettungsdienst sollte im parlamentarischen Verfahren Teil der Notfallreform werden. Wesentlicher Baustein, der auch im Koalitionsvertrag explizit vereinbart wurde: Die Aufnahme des Rettungsdienstes als eigenständiger Leistungsbereich in das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch. Auch hier führte das Ampel-Aus zum Scheitern der Reform.
Entbürokratisierung
Im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampelregierung ein „Bürokratieabbaupaket“ vorgenommen. So sollten etwa überholte Dokumentationspflichten durch technischen Fortschritt ersetzt werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kündigte für Herbst 2024 ein entsprechendes Gesetz an, doch dazu kam es nicht mehr.
Allerdings liegen zahlreiche Vorschläge von den Bundesländern und Verbänden zum Bürokratieabbau auf dem Tisch, die vom Krankenhausbereich über die Qualitätssicherung bis hin zum bürokratiereduzierenden Einsatz der Digitalisierung reichen. Im November 2024 hat die Regierungskommission in einer Stellungnahme ihre Vorschläge vorgelegt. Ob, wann und wie sie aufgegriffen werden, ist allerdings höchst ungewiss.
Finanzierung der GKV
„Wir bekennen uns zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)“, heißt es im Koalitionsvertrag der Ampel. Angesichts der für das Jahr 2023 erwarteten Finanzlücke von 17 Milliarden Euro sollte die Finanzierung der GKV reformiert werden. Nach wochenlangen Protesten von Leistungserbringern und Industrie erblickte im Jahr 2022 als eine Art „Sofortmaßnahme“ das Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FinStG) das Licht der Welt, das für alle Akteure mehr oder weniger tiefe Einschnitte mit sich brachte. So musste die Ärzteschaft unter anderem die Abschaffung der Neupatientenregelung hinnehmen. Eine viel geäußerte Kritik: Das Gesetz verschiebe das Problem nur und löse es nicht.
Bis Ende Mai 2023 sollte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) daher Vorschläge für die künftige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vorlegen. Das ist allerdings nicht mehr erfolgt. Zwar soll das BMG ein Konzept entwickelt haben, dieses ist allerdings im Rahmen der Ressortabstimmung im Bundesfinanzministerium versandet.
Derweil rechnete der GKV-Spitzenverband für das Jahr 2024 mit einem Defizit von rund fünf Milliarden Euro. Die Finanzreserven der Krankenkassen fielen auf ein Rekordtief von rund 4,7 Milliarden Euro. Dies entspricht 0,17 Monatsausgaben. Die gesetzlich vorgesehene Mindestreserve beträgt 0,2 Monatsausgaben.
Prävention, ÖGD und das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit
Im Bereich der Prävention wollte die Ampelregierung das Präventionsgesetz weiterentwickeln und die Primär- und Sekundärprävention stärken. Es sollte außerdem ein Nationaler Präventionsplan sowie konkrete Maßnahmenpakete zu den Themen Alterszahngesundheit, Diabetes, Einsamkeit, Suizid, Wiederbelebung und Vorbeugung von klima- und umweltbedingten Gesundheitsschäden vorgelegt werden. Tatsächlich hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauter im Mai 2024 eine Suizidpräventionsstrategie vorgestellt. Mit dem – von allen Seiten heftig kritisierten – Gesetz zur Stärkung der Herzgesundheit sollte eine bessere Vorsorge in diesem Bereich erreicht werden. Zu einer Verabschiedung kam es allerdings nicht mehr, da die Ampelregierung zerbrochen ist.
Am Ampel-Aus ist auch die Gründung eines Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit zunächst gescheitert. Das Institut sollte sich vor allem um die Vorbeugung von Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kümmern. Weitere Aufgaben sind die Erhebung von Gesundheitsdaten, Modellierungen, die Vernetzung der Gesundheitsämter und Gesundheitskommunikation. Dem Vernehmen nach prüft das Bundesgesundheitsministeriums allerdings derzeit, ob das Institut mit einer Rechtsverordnung doch noch auf den Weg gebracht werden kann.
Auf die Agenda haben sich die Koalitionäre auch die Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes geschrieben. Sie stellten eine Verstetigung des ÖGD-Paktes, den der Bund mit vier Milliarden Euro über einen Zeitraum von 2021 bis Ende 2026 finanziert in Aussicht: „Auf der Grundlage des Zwischenberichts stellen wir die notwendigen Mittel für einen dauerhaft funktionsfähigen ÖGD bereit“, heißt es im Koalitionsvertrag. Doch dann ist der Ampel das Geld ausgegangen. So verkündete Karl Lauterbach im vergangenen Sommer, dass die Fortführung der Finanzierung des ÖGD Aufgabe der Länder sei. Die Bundesregierung sei nicht in der Lage, weitere Mittel zur Verfügung zu stellen.
Barrierefreies Gesundheitswesen
Für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen sollte laut Koalitionsvertrag bis Ende 2022 ein Aktionsplan erarbeitet werden. Das ist erst auf den letzten Metern gelungen. Anfang Dezember 2024 legte das BMG einen solchen Plan vor. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte an, zu prüfen, welche Maßnahmen noch in dieser Legislaturperiode umsetzbar sind. Ob und welche Maßnahmen umgesetzt werden, ist allerdings höchst ungewiss.
Arzneimittel
Der Koalitionsvertrag von 2021 enthielt mehrere Vorhaben im Bereich der Arzneimittelversorgung. Auf der Agenda standen unter anderem eine sichere Versorgung mit Arzneimitteln und Impfstoffen, effiziente und dezentrale Bevorratung von Arzneimittel- und Medizinprodukten und eine Verlagerung der Herstellung nach Deutschland und die EU.
Mitte 2023 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln (ALBVVG) in Kraft getreten. Ziel war es, Versorgungsengpässe zu vermeiden, Lieferketten zu stärken und so die Versorgungssicherheit bei generischen Arzneimitteln zu verbessern. Eine Auswertung der vertragsärztlichen Arzneiverordnungsdaten für die Jahre 2022 bis 2024 durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) legte allerdings nahe, dass das Gesetz weitgehend wirkungslos geblieben ist.
Im Dezember 2023 verabschiedete die Bundesregierung außerdem eine Nationale Pharmastrategie, die unter anderem Anreize für die Ansiedlung von Produktionsstätten in Deutschland setzen und die Rahmenbedingungen für die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln verbessern soll.
Die Koalition plante außerdem, das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarkts (AMNOG) weiterzuentwickeln. Ziel war es, die Möglichkeiten der Krankenkassen zur Begrenzung der Arzneimittelpreise zu stärken und den verhandelten Erstattungspreis bereits ab dem siebten Monat nach Markteintritt gelten zu lassen. Sie steht allerdings nach wie vor aus.
Rechte von Patienten
Im Koalitionsvertrag kündigten die SPD, die FDP und die Grünen an, die Unabhängige Patientenberatung (UPD) in eine „dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen“ zu überführen. Im Mai 2023 trat ein entsprechendes Gesetz in Kraft, dem kontroverse Diskussionen vorangegangen waren. Aufgrund von Verzögerungen beim Gesetz musste die UPD für rund sechs Monate ihre Tätigkeit einstellen.
Cannabis
„Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein“, kündigten die Ampelparteien im Koalitionsvertrag an. Und tatsächlich: Das Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften ist am 1. April 2024, mit Ausnahme der Regelungen zu Anbauvereinigungen und zur Tilgung von Einträgen im Bundeszentralregister, in Kraft getreten."

 SLÄK_1062975209.jpg)







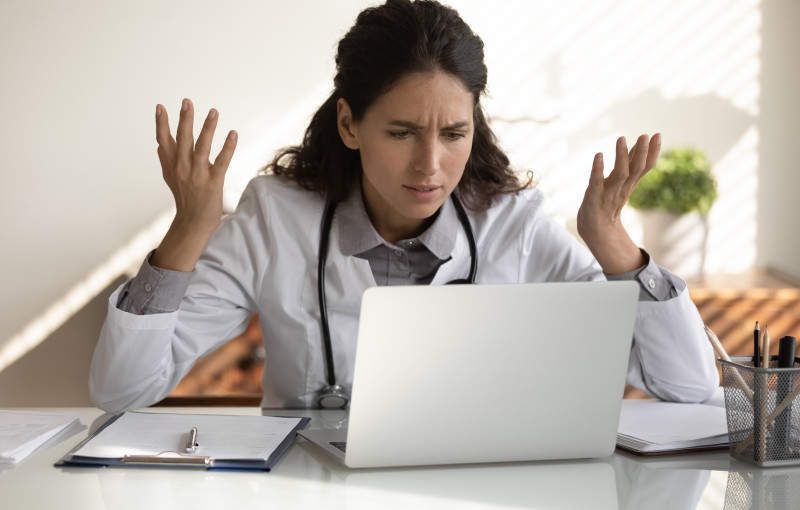

_1202739061.jpeg)