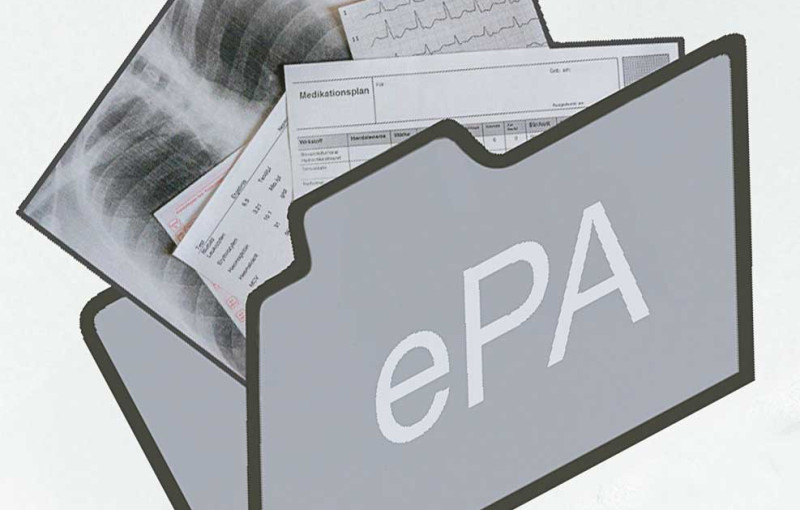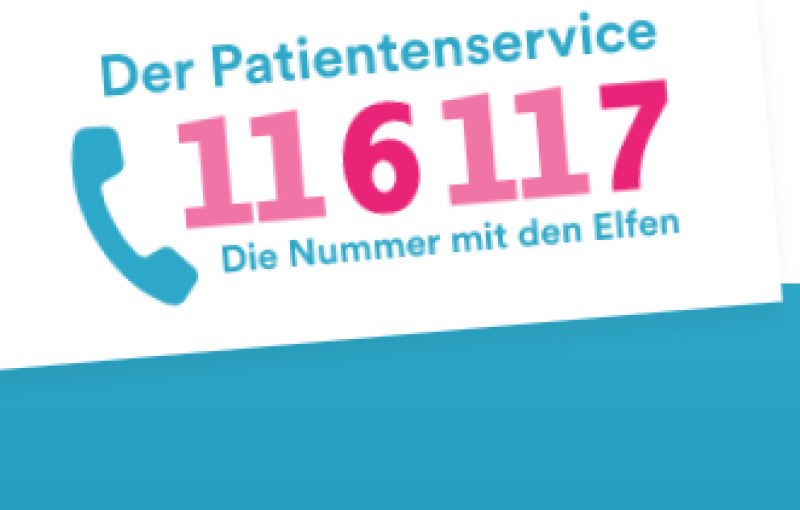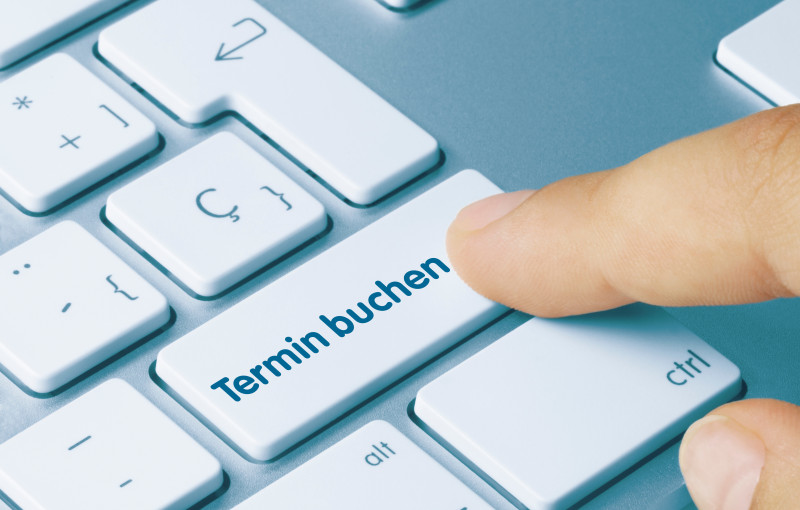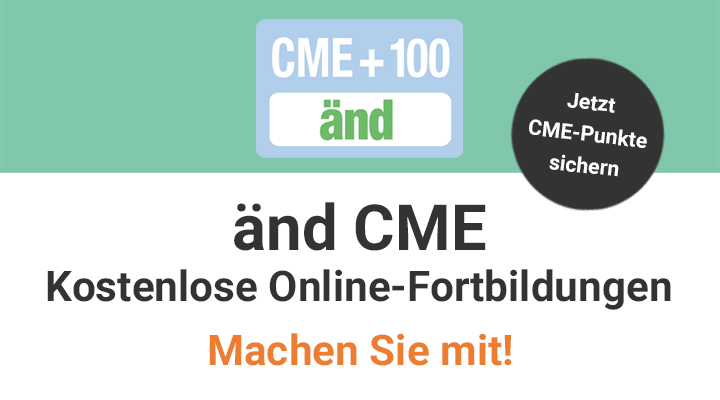Er interessiert sich für „das Böse“
Wer Arzt oder Ärztin wird, steht früher oder später vor der Entscheidung: Wie und für wen will ich arbeiten? Der änd hat mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die sich nicht für eine klassische Praxis- oder Kliniktätigkeit entschieden haben – oder zumindest nicht ausschließlich. Heute: Anstaltspsychiater Uwe Meinecke.
 ©Jugendanstalt Hameln
Uwe Meinecke ist seit fast zehn Jahren in der Jugendanstalt Hameln tätig.
©Jugendanstalt Hameln
Uwe Meinecke ist seit fast zehn Jahren in der Jugendanstalt Hameln tätig.
Die Frage, wie viele Personen in der Jugendanstalt Hameln psychisch krank sind, ist falsch gestellt, findet Uwe Meinecke. „Leichter wäre die Frage zu beantworten: Wie viele sind es nicht?“, sagt er im Gespräch mit dem änd. Denn gesund sei kaum einer von ihnen.
Meinecke ist Psychiater. Und zwar nicht irgendeiner. Er leitet die psychiatrische Station der Einrichtung in der niedersächsischen Stadt rund 50 Kilometer vor Hannover. Dort hat er mit den jungen Straftätern alle Hände voll zu tun – denn die meisten sind psychisch krank. Sie leiden unter Panikattacken, dem fetalen Alkoholsyndrom, ADHS, Posttraumatischen Belastungsstörungen, Schizophrenie. Sie brauchen Unterstützung, die einen mehr, die anderen weniger.
Wer in der Jugendanstalt Hameln landet, hat gestohlen, betrogen oder erpresst. Oder gar vergewaltigt oder gemordet. Die Einrichtung ist die größte in Deutschland und hat insgesamt Platz für rund 650 männliche Jugendliche. Aktuell sind rund 400 Menschen aus rund 70 Nationen inhaftiert.
Was sie gemein haben, erzählt Meinecke, ist, dass sie nicht schlafen können. Sie schlafen nicht ob der ungewohnten Umgebung, ob der harten Matratzen, ob des Geräuschpegels oder ob der Probleme, die das Zusammenleben in Gefangenschaft mit sich bringt.
Oder ob der Taten, die sie begangen haben. Ein Gefangener hat sein eigenes Kind totgeschlagen und glaubt, nachts die Schreie des Babys zu hören, er ist traumatisiert. Und immer wieder suizidal. Leute wie er kommen auf Meineckes Station, die 20 Betten vorhält, drei Zimmer haben Kameraüberwachung. Er sieht die Gefangenen zur Visite, doch er verschreibt ihnen nicht nur Medikamente. Er geht auch mit ihnen spazieren, macht mit ihnen Sport. Das alles ist Teil der Therapie. Es mache für die Jugendlichen „viel aus“, dass sich der Arzt selbst eine Sporthose anzieht, so wie sie. Aber es ist für ihn auch diagnostisch interessant, beispielsweise erkenne er schnell, wer unter ADHS leidet, weil sich die Betroffenen nie lang mit einer Übung aufhielten.
„Ich habe ein menschliches Interesse daran, wie jemand so etwas machen kann“
Der Umgang sei mitunter schwierig, viele der Jugendlichen seien aggressiv, auch untereinander. Schon in diesem jungen Alter bauen die Gefangenen ihre eigene Hierarchie auf: Wer Kindern etwas angetan hat, steht unten, „der muss aus Sicht der anderen einen draufkriegen“. Weil die Aggression auch die Mitarbeitenden trifft, gibt es in den Räumen immer mehrere Fluchtwege, allein ist man mit den Patienten auch nicht. Außerdem trägt jeder ein sogenanntes Personennotsignalgerät, eine Art Funkgerät, am Körper, mit dem er nach Unterstützung rufen kann.
Wie hält man es aus, mit Straftätern zu arbeiten, die nicht nur aggressiv sind, sondern im schlimmsten Fall jemanden umgebracht haben? Für Meinecke ist der Blickwinkel entscheidend. Man könne einfach auf die Tat schauen und sie verurteilen, sagt er. Oder man nähert sich ihr wissenschaftlich und mit Blick in die Zukunft. „Ich habe ein menschliches Interesse daran, wie jemand so etwas machen kann“, so Meinecke. Und er stelle sich die Frage, wie sich ein Täter weiterentwickeln könne. Wie er mit dem, was er getan hat, weiterleben kann. Und wie sich verhindern lässt, dass er seine Taten wiederholt.
Seit fast zehn Jahren arbeitet der Arzt, der eigentlich in Dortmund lebt, unter der Woche in Hameln. Doch „hinter Mauern“, wie er es nennt, ist er bereits seit 1999. Er sei zufällig in die forensische Psychiatrie gerutscht und fand die Arbeit „total spannend“. Er habe einen Patienten gehabt, der mehrere Frauen ermordet hatte, und in den jeder andere Arzt die Hoffnung bereits verloren hatte. Ein Serientäter. Ihn reizte die Auseinandersetzung „mit dem Bösen“.
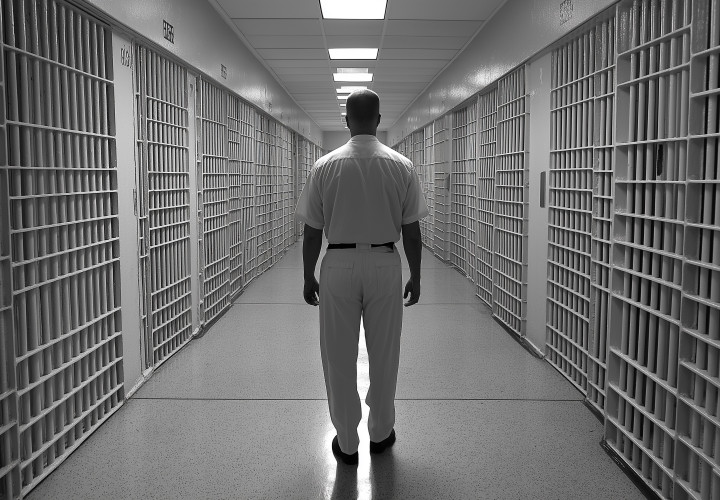 ©cosmic neural/stock.adobe.com
Ärztinnen und Ärzte, die in Gefängnissen arbeiten, müssen aus Sicht von Meinecke dazu in der Lage sein, sich in einen großen Organismus einzufügen.
©cosmic neural/stock.adobe.com
Ärztinnen und Ärzte, die in Gefängnissen arbeiten, müssen aus Sicht von Meinecke dazu in der Lage sein, sich in einen großen Organismus einzufügen.
Als sich Meinecke 2016 dazu entschied, in der Anstalt zu arbeiten, war es die erste Einrichtung im Bundesland, die eine psychiatrische Abteilung plante. Und in dieser Abteilung haben die Mitarbeitenden aus Sicht des Psychiaters viele Möglichkeiten, die Gefangenen zu unterstützen, eine „therapeutische Atmosphäre“ aufzubauen und den jungen Gefangenen ein familiäres Miteinander zu vermitteln. Für gewöhnlich halten niedergelassene Psychiater nur einmal in der Woche eine Sprechstunde in Anstalten ab.
Das Konzept der Einrichtung überzeugt Meinecke. "Meine persönliche Meinung ist: Wenn man strafen will um der Sühne Willen, dann ist das Altes Testament.“ Gefängnisse müssten Lern-Orte sein, in denen sich Gefangene weiterentwickeln können. In Hameln seien die Jugendlichen verpflichtet zu arbeiten, eine Ausbildung oder einen Schulabschluss zu absolvieren. Insgesamt könnten sie sich aus 30 Berufen einen aussuchen. In diesem „Dorf“, wie Meinecke das Gefängnis nennt, gebe es einen großen Marktplatz, einen Frisör, eine Kfz-Werkstatt.
Meinecke empfindet es als schwierig, sich mit allen Beteiligten auf ein geeignetes Vorgehen für Insassen zu einigen. Zum Beispiel gibt es den Fall eines Häftlings, der sich bei Stress immer ins Bein schneidet. Da die Psychiatrie Videoüberwachung hat, verlegt man ihn dorthin. Und er will auch unbedingt dortbleiben. Warum, das stellt sich erst nach einigen Gesprächen raus: Er hat Tabakschulden und traut sich nicht mehr unter die anderen Insassen. Und in die psychiatrische Abteilung kommt keiner rein, der nicht dort aufgenommen wurde. Meinecke nimmt ihn auf – aber nur unter der Bedingung, dass er arbeiten geht, obwohl er Angst hat, auf die anderen Gefangenen zu treffen. „Er muss ja mit den Folgen seiner Taten leben.“ Aber auch das bedarf einer Abstimmung. „Jeder Mitarbeiter hat eine andere Vorstellung davon, was gut ist.“ Einen gemeinsamen Nenner zu finden, sei schwierig. Weitere Besprechungen seien nötig, wenn beispielsweise Disziplinarmaßnahmen angeordnet werden müssten: Dafür sei sein Vollzugsabteilungsleiter zuständig.
„90 Prozent der Arbeit machen mir Spaß“
Und sowieso wird viel miteinander gesprochen: In Konferenzen besprechen die Mitarbeitenden, welche Patienten aufgenommen oder entlassen werden. Auch bei der Übergabe – neben Meinecke ist eine Psychiaterin in der Einrichtung tätig – spreche man über die Patienten. Einmal in der Woche tauscht sich die psychiatrische mit der medizinischen Abteilung aus. Bei der Anstaltsabteilungskonferenz erfahren sie darüber hinaus beispielsweise von neuen Regeln für die Anstalt.
Um als Arzt im Gefängnis tätig zu sein, „muss man erstmal ein guter Arzt sein“, sagt Meinecke. Doch man muss auch in der Lage sein, sich in einen großen Organismus einzufügen und nicht der Chef von allem zu sein. „Wenn von oben was nicht gewollt ist, wenn die Leitung oder das Ministerium nicht will, dann kann man nichts machen.“ Doch er selbst habe für sich viel Gestaltungsspielraum und das Gefühl, „die Anstalt freut sich, dass es eine psychiatrische Abteilung gibt, in die schwierige Patienten kommen“. In anderen Gefängnissen sei es weit schwieriger, das Arztsein mit den Sicherheitsvorkehrungen unter einen Hut zu bringen.
Meinecke hat bislang keinen Grund gefunden, warum er diese Arbeit beenden sollte, erzählt er. „Ich hätte woanders mehr verdienen können, aber dann hätte ich viel mehr Papierkram und Arbeit, die mir keinen Spaß macht.“ Sein Gehalt orientiere sich am Tarifvertrag des Marburger Bundes, er erhalte ein Oberarztgehalt – allerdings absolviere er weder Nacht- noch Wochenenddienste. Dadurch habe er auch mehr Freizeit. „90 Prozent der Arbeit machen mir Spaß“, sagt er, er könne sie mit den Patienten und Mitarbeitenden verbringen statt mit Computern und Formularen.
Uwe Meinecke ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leitender Psychiater der Jugendanstalt Hameln.
Die Einrichtung hat Platz für insgesamt 655 männliche Jugendliche und hält 580 Haftplätze für den geschlossenen Vollzug sowie 75 für den offenen Vollzug in Göttingen vor. Aktuell sind rund 400 Menschen aus rund 70 Nationen inhaftiert.