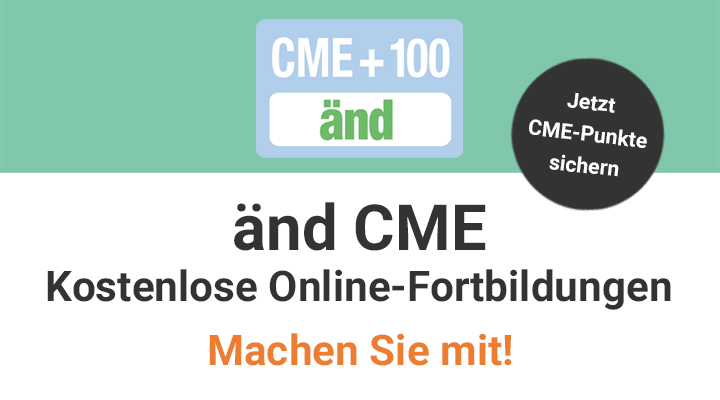Steigendes Risiko durch pathogene Vibrionen an Nord- und Ostsee
Das Wasser an den deutschen Küsten nähert sich der 20-Grad-Marke. Die angenehmen Temperaturen kommen aber nicht nur Badenden zugute: Humanpathogene Vibrionen vermehren sich dann auch besonders stark. Das Robert Koch-Institut informiert daher in seinem aktuellen „Epidemiologischen Bulletin“ (27/2025) umfassend über das Gesundheitsrisiko durch Vibrionen – ein Problem, das angesichts des Klimawandels für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland zunehmend dringlicher wird.
 ©Sina Ettmer/stock.adobe.com
Baden mit Umsicht: Menschen mit schlecht heilenden Wunden oder anderen Verletzungen der Hautbarriere sollten sich vor dem Bad in Nord-und Ostsee über die Vibrionen-Konzentration informieren.
©Sina Ettmer/stock.adobe.com
Baden mit Umsicht: Menschen mit schlecht heilenden Wunden oder anderen Verletzungen der Hautbarriere sollten sich vor dem Bad in Nord-und Ostsee über die Vibrionen-Konzentration informieren.
Zu den Risikogruppen für schwere Krankheitsverläufe nach Infektionen mit humanpathogenen Vibrionen gehören nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts „neben älteren Menschen und immunsupprimierten Personen auch Menschen mit chronischen Erkrankungen wie schweren Herzkreislauf- und Lebererkrankungen, chronischer Niereninsuffizienz oder Diabetes mellitus“.
Im Fokus steht vor allem die Ostsee: Sie „bietet aufgrund ihres niedrigen Salzgehaltes ein ideales Habitat für Vibrionen und stellt eines der sich am schnellsten erwärmenden Meeresökosysteme weltweit dar“, so das RKI. Daher müsse auch in Deutschland von einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen in den kommenden Jahren ausgegangen werden.
Zielgruppe Ärzteschaft
„Personal in medizinischen Einrichtungen, Gesundheitsämter und vor allem vulnerable Bevölkerungsgruppen sollten daher über die Möglichkeit und Gefahr von NCV-Infektionen [NCV: Nicht-Cholera-Vibrionen] und deren potenziell schwere Verläufe informiert werden“, schreibt das RKI. „Insbesondere das Bewusstsein für die Möglichkeit schwerer Wundinfektionen mit Vibrio vulnificus und V. cholerae non-O1/non-O139, die zu schweren septischen Verläufen führen können, muss in der Ärzteschaft geschärft werden, um Verzögerungen bei der Einleitung einer erfolgreichen Behandlung möglichst zu vermeiden.“
Übertragungswege & Krankheitssymptome
Ein häufiger Infektionsweg ist laut RKI „die Aufnahme von Vibrionen durch rohe oder unzureichend erhitzte Nahrung marinen Ursprungs, z. B. durch den Verzehr von Austern oder anderen Meeresfrüchten sowie Fisch“. Diese Lebensmittelinfektionen können leichte bis z. T. auch schwer verlaufende Magen-Darm-Erkrankungen zur Folge haben, die mit Übelkeit, Bauchkrämpfen, Erbrechen und Durchfall verbunden sind. Möglich ist auch eine Sepsis, die in seltenen Fällen tödlich verlaufen kann.
Ein Risiko für Badende sind bereits vorhandene, schlecht heilende Wunden oder andere Verletzungen der Hautbarriere (z. B. durch Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, aber auch frisch gestochene Tätowierungen), über die die Erreger in den Körper eindringen können, so das RKI. Besonders gefährlich seien Wundinfektionen mit Vibrio vulnificus. Diese könnten innerhalb kürzester Zeit zu tiefgreifenden Nekrosen führen. Eine sehr geringe Bakterienanzahl könne genügen, um eine Wundinfektion hervorzurufen. Die Behandlung ist dann langwierig, in einigen Fällen sei sogar „die Amputation der betroffenen Extremitäten zur Rettung der Erkrankten notwendig“.
Typisch bei Kindern sind Ohrinfektionen, die nach dem Schwimmen oder Baden im Flachwasser auftreten. Betroffen sei meist der äußere Gehörgang. Deutlich seltener sind den Angaben zufolge Mittelohrinfektionen.
Inkubationszeit & Antibiotikatherapie
Die Inkubationszeit von Infektionen mit Vibrionen hängt von der verursachenden Vibrionenart, der Infektionsdosis und dem Immunstatus der Betroffenen ab: Im Allgemeinen liege sie zwischen vier und 96 Stunden. „Vor allem durch V. vulnificus ausgelöste Wund- und Weichgewebeinfektionen schreiten sehr schnell fort“, so das RKI. Deshalb: „Eine antibiotische Kombinationstherapie mit Tetrazyklinen und Cephalosporinen der 3. Generation sowie ggf. Gyrasehemmern sollte daher, wenn möglich, unmittelbar nach Erkrankungsbeginn eingeleitet werden – notfalls auch, wenn eine diagnostische Bestätigung noch aussteht.“
Die Überwachung in Deutschland
Eine deutschlandweite, flächendeckende Überwachung zum Vibrionen-Vorkommen in gefährdeten Oberflächengewässern ist laut den Angaben des RKI „derzeit nicht implementiert, daher kann das tatsächliche Risiko für die öffentliche Gesundheit nur unzureichend bewertet werden“. Für offizielle Badegewässer gilt die europäische Badegewässerrichtlinie. Sie legt die Mindestanforderungen an die hygienische Badegewässerqualität in Europa fest, enthält laut RKI aber keine Anforderungen an den Vibrionen-Nachweis. Einige Bundesländer mit Badegewässern, die bekannt für das Vorkommen humanpathogener Vibrionen sind, würden in den Sommermonaten dennoch die Vibrionen-Konzentrationen messen. Eine allgemeine Meldepflicht für Vibrionen-Infektionen besteht in Deutschland seit März 2020 (gemäß Infektionsschutzgesetz).
Interaktive Karte „Vibrio Map Viewer“
Für aktuelle Daten verweist das RKI auf das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Es stellt die interaktive Karte „Vibrio Map Viewer“ für die Nord- und Ostsee zur Verfügung, die das aktuelle Risiko für Massenvermehrungen von Vibrionen aus den Oberflächentemperaturen sowie dem Salzgehalt errechnet. „Dieses Instrument zeigt eindrucksvoll das steigende Risiko des Vorkommens von humanpathogenen Vibrionen im Wasser im Verlauf von heißen Sommermonaten an den Küsten Deutschlands und angrenzender Nachbarländer“, schreibt das RKI.
Hintergrund: Was sind Vibrionen?
Bakterien der Gattung Vibrio („Vibrionen“) leben weltweit in Meer- und Süßwasser. Sie kommen freischwimmend in der Wassersäule vor oder sind an biotische oder abiotische Oberflächen gebunden. Manche leben auch im Verdauungstrakt von Fischen, Krustentieren, Muscheln und Quallen. Vibrionen sind gram-negative, bewegliche, meist kommaartig geformte Stäbchen, die mäßig bis ausgeprägt halophil (salzliebend) sind. Sie besitzen die Fähigkeit, unter aeroben oder fakultativ anaeroben Bedingungen zu wachsen, wobei sie neben hohen Salzkonzentrationen auch hohe pH-Werte tolerieren können.
Von den über 150 bekannten Vibrionenarten gelten etwa ein Dutzend als humanpathogen. Bekannteste Art ist sicherlich der Cholera-Erreger Vibrio cholerae. Von den anderen humanpathogenen Arten – den so genannten Nicht-Cholera-Vibrionen (NCV) – kommen einige natürlicherweise auch in deutschen Gewässern vor: vorzugsweise in salzhaltigen Gewässern in Küstennähe wie beispielsweise Flussmündungen, Buchten oder Bodden. Vibrionen wurden aber auch schon in leicht salzhaltigen Binnengewässern nachgewiesen. Und wenn die Temperaturen der Oberflächengewässer über 20° C steigen und der Salzgehalt zwischen ca. 0,5 und 2,5 % liegt, vermehren sie sich besonders gut.



United States Department of Health and Human Services_888708448.png)







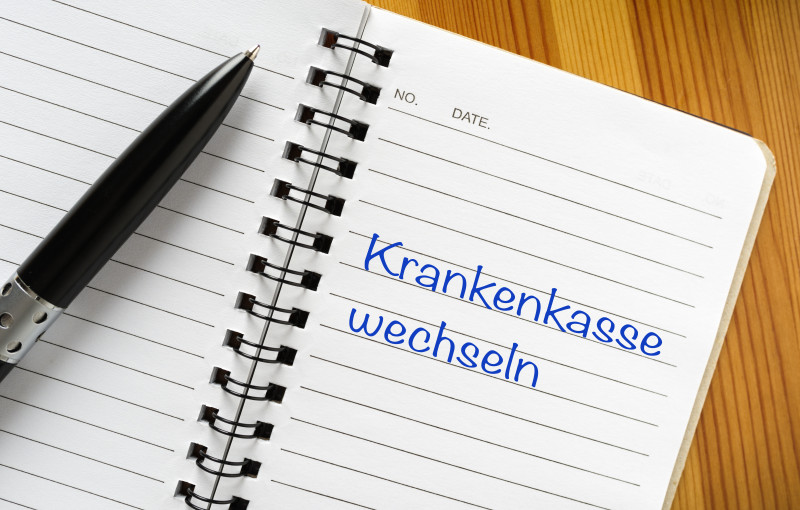




mnirat_adobe_26369007.jpg)