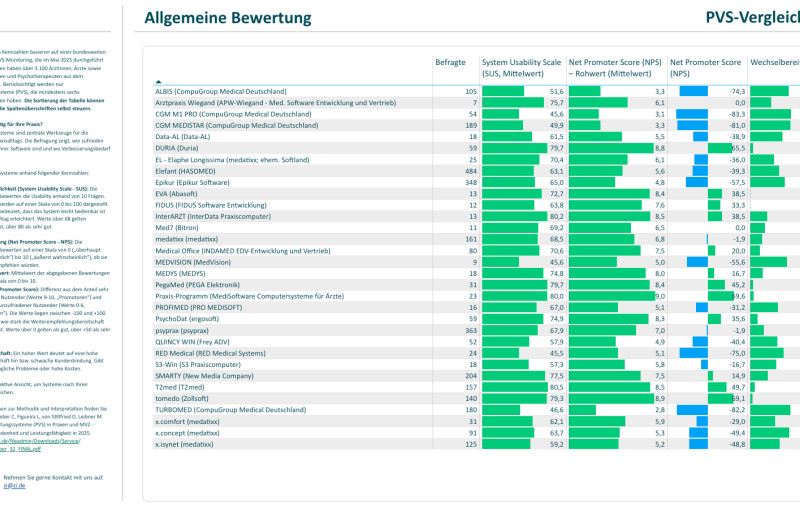„Post-COVID ist ganz klar eine psychosomatische Erkrankung“
Der Bund investiert 500 Millionen Euro in die Erforschung von postinfektiösen Erkrankungen und ME/CFS. „Eine absolute Fehlallokation von Mitteln! Gerade in Zeiten massiv knapper Kassen, gekürzter Budgets für Universitäten und öffentliche Fördereinrichtungen“, wertet Prof. Christoph Kleinschnitz von der Universität Essen diesen Schritt.
 © Andre Zelck
© Andre Zelck 
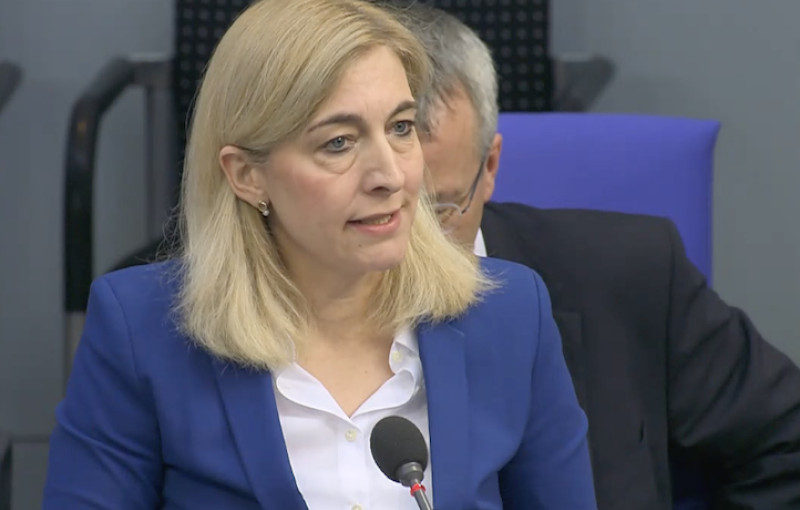
_1908184286.jpeg)





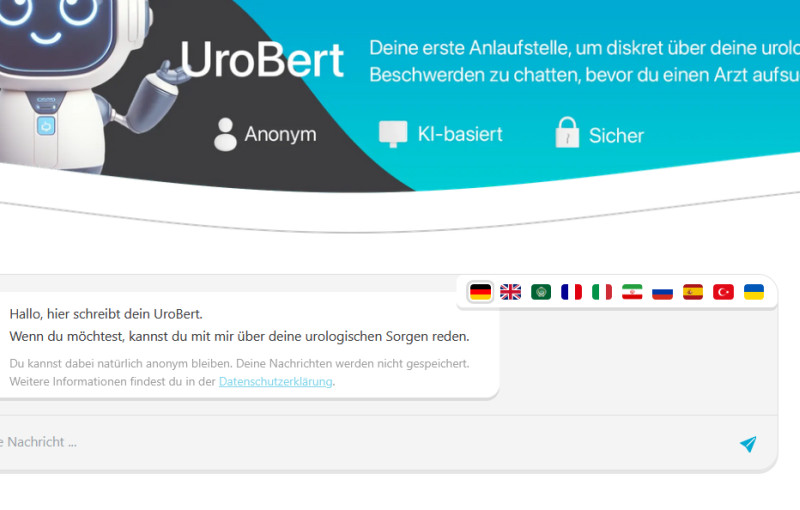
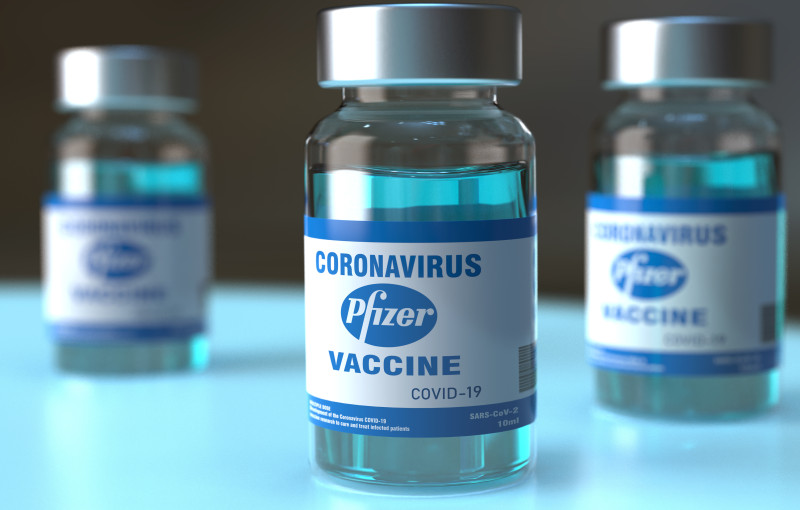



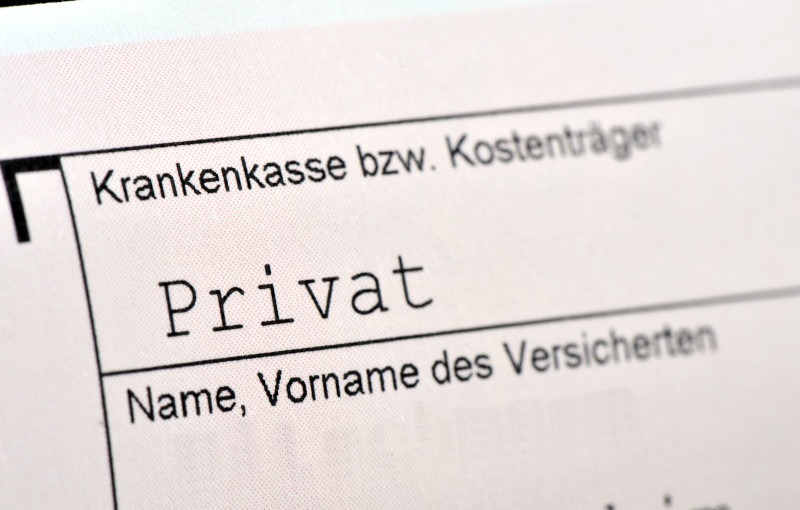

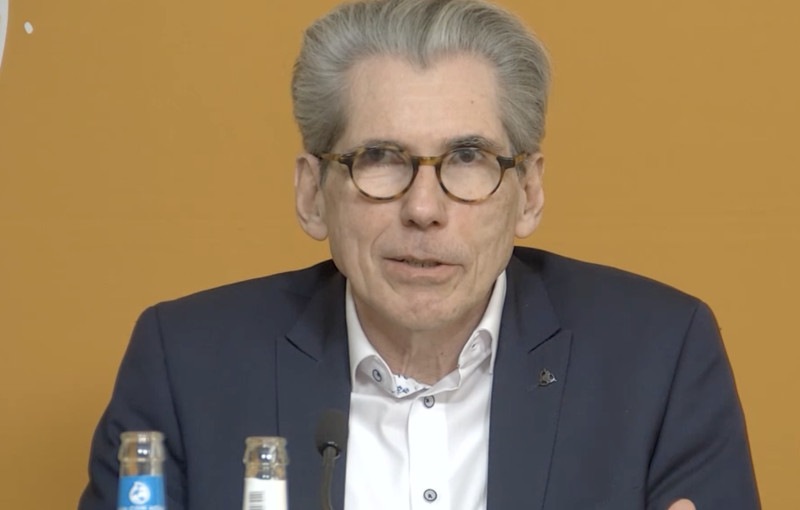

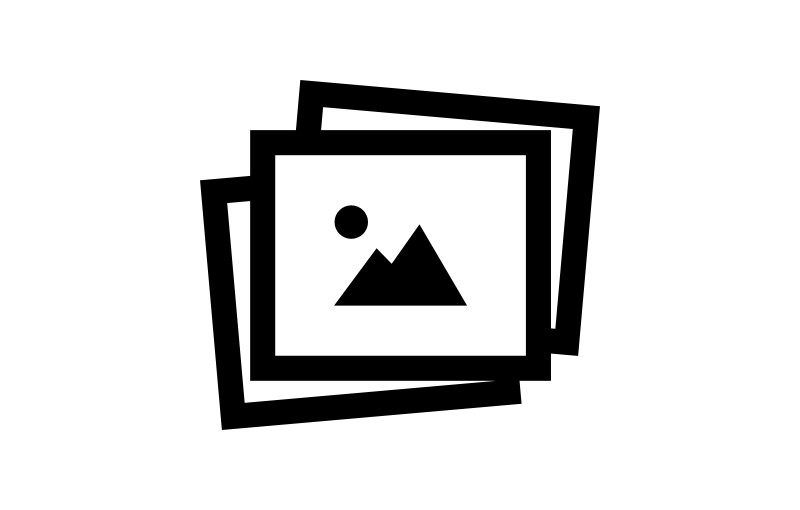Andrea Gaitanides_adobe_1481161567.jpg)