Legal und trotzdem nicht harmlos!
Ein 18-jähriger Patient stellt sich in der Notaufnahme vor, da er akut einen stechenden zentral thorakalen Schmerz verspürte, der bis in den Hals ausstrahlt und sich in Rückenlage verstärkt. Schnell kommt heraus: Der junge Mann hat ein Pneumomediastinum. Aber warum?
 ©Corinne/stock.adobe.com
Ein junger Mann muss nach einer exzessiven Feier ins Krankenhaus. Schuld war wohl die exzessive Inhalation von Lachgas (Symbolbild).
©Corinne/stock.adobe.com
Ein junger Mann muss nach einer exzessiven Feier ins Krankenhaus. Schuld war wohl die exzessive Inhalation von Lachgas (Symbolbild).
Bei der Erstuntersuchung ist der Patient wach, ansprechbar und respiratorisch stabil. Die Vitalparameter bei Aufnahme sind unauffällig. Bis auf einen gelegentlichen Tabakkonsum sowie die Nutzung von E-Zigaretten (Vaping) ist die Anamnese leer.
Klinische Untersuchung und Diagnostik
Bei der körperlichen Untersuchung stellen die Ärztinnen und Ärzte ein palpables subkutanes Emphysem im Halsbereich fest und lassen daraufhin eine Röntgenaufnahme des Thorax anfertigen, die das Emphysem bestätigt. Weiterführende Untersuchungen, einschließlich arterieller Blutgasanalyse und Elektrokardiogramm (EKG), ergeben keine pathologischen Befunde. Der Troponinwert liegt im Normbereich (3,9 ng/L).
In einer Computertomografie (CT) von Hals und Thorax wird schließlich ein ausgeprägtes Pneumomediastinum nachgewiesen. Die Lungen weisen keine Infiltrate auf, auch der knöcherne Thorax ist unauffällig. Im weiteren Verlauf wird anhand einer Kontrastmitteluntersuchung eine Perforation des Ösophagus ausgeschlossen.
Nochmal eine Anamnese
Nach der Diagnosestellung befragen die Behandelnden den Patienten erneut. Nun berichtete er, am Nachmittag fünf Ballons mit Distickstoffmonoxid (Lachgas) inhaliert zu haben, außerdem sei es zum Konsum von Kokain und Ecstasy gekommen. Etwa sechs Stunden später traten die Thoraxschmerzen auf.
Während des gesamten stationären Aufenthalts blieb der Patient hämodynamisch stabil. Schließlich entlässt sich der Patient gegen ärztlichen Rat selbst und ist anschließend nicht mehr für eine Nachsorge erreichbar.
Ambulant oder Behandlung im Krankenhaus?
„In Anbetracht der gutartigen Natur der Krankheit ist noch unklar, ob diese Patienten ambulant behandelt werden können oder ob sie immer einen Krankenhausaufenthalt benötigen“, erklären die Autorinnen und Autoren. Aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer ernsten Erkrankung sei eine umfassende Untersuchung jedoch empfohlen. Es sei wichtig, die Nebenwirkungen der Lachgas-Inhaltaion zu kennen und zu erkennen.
Hamman-Zeichen und Macklin-Effekt
Das spontane Pneummediastinum (SPM) wurde erstmals 1939 von Hamman beschrieben. Die bei der Auskultation hörbare Krepitation, die mit dem Herzschlag auftritt, ist bekannt als Hamman's Zeichen.
Bei akuten Thoraxschmerzen gilt es an eine ganze Bandbreite von Differenzialdiagnosen zu denken, von denen einige lebensbedrohlich sein können. Bei jungen Männern ist der Spontanpneumpthorax eine wichtige Differenzialdiagnose, die je nach Ausmaß zu mehr oder weniger starken Beschwerden und respiratorischer Insuffizienz führt. Das Boerhaave-Syndrom - eine spontane Ösophagusruptur infolge eines intraösophagealen Druckanstiegs - ist mit einer hohen Sterblichkeit verbunden.
Zwei Phänomene könnten das SPM erklären:
- Der Macklin-Effekt: Ruptur von terminalen Alveolen aufgrund einer starken intrathorakalen Druckerhöhung, z.B. bei Valsava-Manövern.
- Direkte toxische Wirkung von Wärme und Vasokonstriktion.
Drogenkonsumenten führen während des Einatmens in der Regel ein kräftiges Atemhaltemanöver durch, das zum Anstieg des intrathorakalen Druckes und damit zum SPM führen könnte.
Lachgas und seine Nebenwirkungen sind nicht zum Lachen
Lachgas wurde ursprünglich zur Sedierung verwendet, heutzutage wird es vor allem in der Zahnmedizin eingesetzt. Es findet aber als Partydroge aufgrund der euphorisierenden Wirkung zunehmend Nutzer im Freizeitbereich. Zehn bis zwanzig Prozent der jungen Menschen haben bereits einmal Lachgas konsumiert.
Eine körperliche Abhängigkeit ist nicht zu erwarten, der Gebrauch kann jedoch zu psychischer Abhängigkeit führen. Teilweise wird zwecks intensiverer Inhalation des Gases aus einem Ballon eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, was den Tod durch Ersticken zur Folge haben kann. Schwindel, Kopfschmerzen und Ohnmacht sind weitere Nebenwirkungen des Gases. Manche Konsumentinnen und Konsumenten inhalieren das Gas auch direkt aus einer Kartusche, sodass mit Schäden an Zähnen, Lippen, Zunge und an den Bronchien zu rechnen ist. Durch die Verdunstungskälte (bis zu minus 55 Grad Celsius) können die Lippen auch an der Kartusche festfrieren.
Langfristig beeinträchtigt Lachgas die Verarbeitung von Vitamin B12, mit der Folge von Schäden an den Myelinscheiden der Nerven. Die Vitamin-B12-Spiegel bleiben davon allerdings unverändert.
Andreas Berger-Waltering aus dem IQWiG-Ressort Gesundheitsinformation (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) betont hierzu in einer Stellungnahme zu dem Thema: „Die Rechnung ‚legal gleich harmlos‘ geht hier nicht auf.“
Fallbericht:
George, M., Jindal, K. & Michailidis, A. Pneumomediastinum after laughing gas inhalation: not a laughing matter anymore—a case report. J Med Case Reports 19, 156 (2025).
https://doi.org/10.1186/s13256-025-05053-0
IQWiG: Lachgas


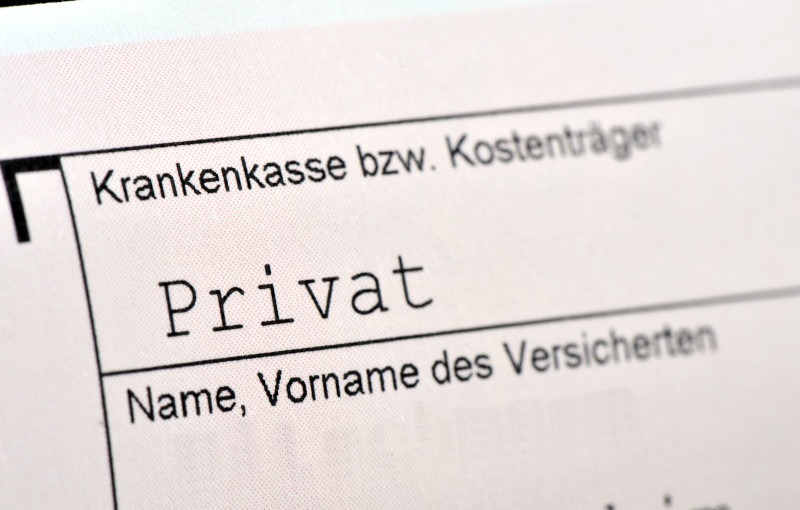

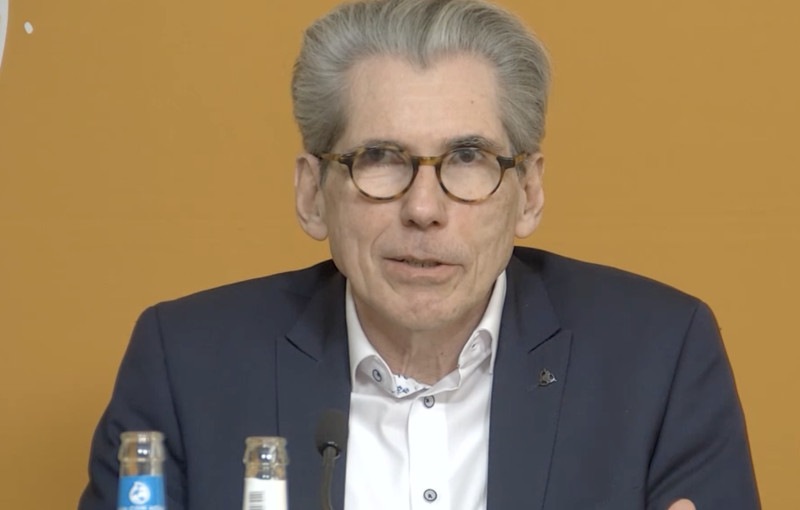

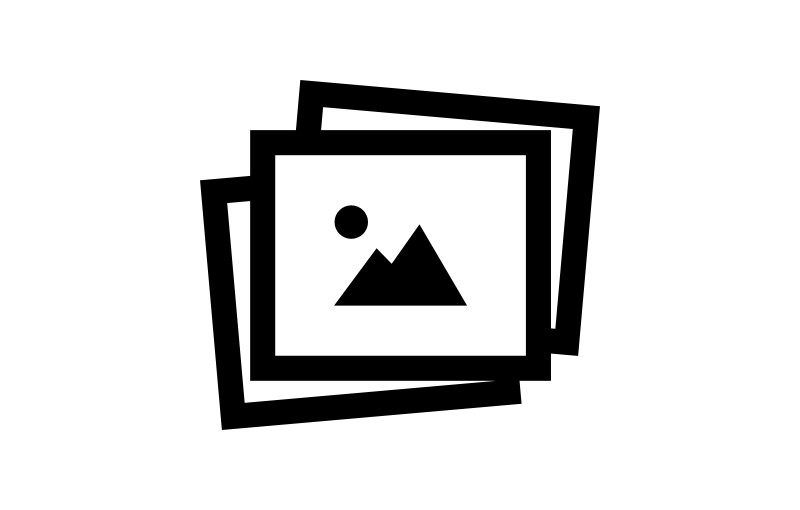Andrea Gaitanides_adobe_1481161567.jpg)

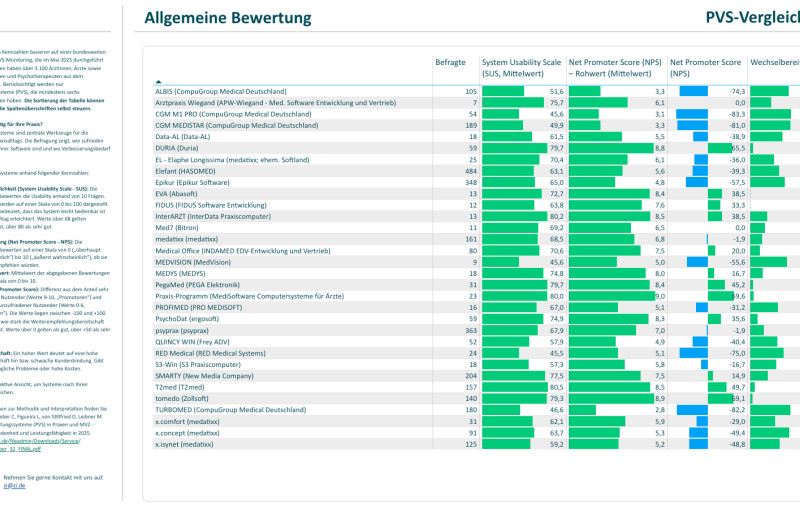
woravut_adobe_246321746.jpeg)






United States Department of Health and Human Services_888708448.png)



