Slush-Eis und Sex – wenn Genuss Kopfschmerzen bereitet
Die zwei häufigsten Kopfschmerzarten sind der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Doch beim Schmerzkongress in Mannheim wurde auch ein Blick auf seltenere primäre Kopfschmerzarten geworfen. Diese treten bei Aktivitäten auf, die eigentlich angenehm sein sollten: Beim Eis essen oder im Rahmen von sexuellen Aktivitäten.
 ©Pattarisara/stock.adobe.com
Viele Menschen trinken gerade in den Sommermonaten gerne eisgekühlte Getränke. Bei etwa der Hälfte der Menschen löst dies einen deutlichen Schmerz aus, der auf der Schmerzskala im Schnitt bei etwa fünf liegt (Symbolbild).
©Pattarisara/stock.adobe.com
Viele Menschen trinken gerade in den Sommermonaten gerne eisgekühlte Getränke. Bei etwa der Hälfte der Menschen löst dies einen deutlichen Schmerz aus, der auf der Schmerzskala im Schnitt bei etwa fünf liegt (Symbolbild).
Kältebedingter Kopfschmerz (HICS)
Der kältebedingte Kopfschmerz, medizinisch als „headache attributed to ingestion or inhalation of a cold stimulus“ (HICS) und umgangssprachlich auch „Brainfreeze“ genannt, ist auf die Einnahme oder Inhalation eines Kältereizes zurückzuführen. „Früher nannte man das Phänomen icecream-headache“, erklärte Dr. Thomas Kraya vom Klinikum St. Georg in Leipzig. Es handelt sich dabei um einen kurz anhaltenden frontalen oder temporalen Schmerz, der intensiv sein kann und vor allem durch eiskaltes Wasser oder Eissorten wie Slush-Eis ausgelöst wird. In Versuchen mit Probanden war das Trinken von Eiswasser deutlich häufiger mit kältebedingten Kopfschmerzen assoziiert als das Lutschen von Eiswürfeln.
Möglich ist es auch, dass äußere Reize, beispielsweise kalter Wind, diese Form von Kopfschmerzen verursachen.
Prävalenz in der Bevölkerung hoch
Die Prävalenz hat Kraya selbst in einer Studie erforscht: Hierfür wurden 618 Fragebögen ausgewertet, die ergaben, dass 51,3 Prozent der Befragten HICS kennen, Männer und Frauen waren hierbei gleich häufig betroffen. Die Dauer des Kopfschmerzes betrug in 92,7 Prozent der Fälle weniger als 30 Sekunden und typischerweise war der Schmerz frontal oder parietal lokalisiert, in knapp 17 Prozent der Fälle auch okzipital.
Familiäre Veranlagung
Eine weitere Studie untersuchte, ob es eine familiäre Prädisposition gibt. „Wenn Vater oder Mutter auch unter kältebedingtem Kopfschmerz leiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kinder es auch kennen. Und wenn Eltern noch von anderen Kopfschmerzarten berichtet hatten, war dies ebenfalls ein Risiko für HICS bei ihren Kindern“, erklärte der Neurologe. Pathophysiologisch liege dem Schmerz eigenen Versuchen zufolge ein gesteigerter Blutfluss in der A.cerebra media zugrunde.
„Ponytail-headache“ und Schmerzen durch Hüte
Neben dem kältebedingten Kopfschmerz stellte der Oberarzt aus Leipzig noch zwei Kopfschmerzarten vor, die bei Druck und Zug auf den Kopf bzw. der Kopfhaut entstehen: Druck beispielsweise durch Hüte - auch wenn sie anamnestisch „gut sitzen“ - oder, und dies sei im Rahmen der COVID-19-Pandemie des Öfteren vorgekommen, durch eng anliegende FFP2-Masken. Außerdem kann Zug auf die Kopfhaut durch das Binden von Zöpfen und die damit verbundene Traktion am Weichgewebe Kopfschmerzen auslösen. Beide Phänomene verschwinden etwa eine Stunde nach Entfernen des äußeren Reizes. Es besteht eine Prädisposition beim weiblichen Geschlecht und bei Menschen mit Migräne.
Primärer Kopfschmerz bei sexueller Aktivität (KSA)
Der Name ist Programm: Der Kopfschmerz tritt bei sexueller Erregung auf und kann zu großen Verunsicherungen bei den Betroffenen führen. Diese sind nicht ganz unbegründet, erklärte Prof. Stefan Evers aus Coppenbrügge zu Beginn des Vortrags. „Die häufigste Ursache für geplatzte Aneurysmen ab einem Alter von 60 Jahren ist die sexuelle Aktivität.“ Das bedeute, dass bei jedem erstmaligen Auftreten von starken Kopfschmerzen im Rahmen von Geschlechtsverkehr oder starker sexueller Erregung der Ausschluss einer Subarachnoidalblutung oder arteriellen Dissektion obligat sei - vor allem im höheren Lebensalter.
Der Kopfschmerz bei sexueller Aktivität verstärkt sich typischerweise mit der Erregung und entlädt sich explosionsartig vor oder mit dem Orgasmus. Die Dauer kann variieren und von einer Minute bis hin zu 24 Stunden in starker Intensität, oder bis zu drei Tagen in milder Intensität anhalten.
Männer häufiger betroffen
Es gibt zwei Altersgipfel: Einer liegt bei 20 bis 24 Jahren und einer bei 35 bis 44 Jahren. Männer sind drei- bis viermal häufiger betroffen. In 19 bis 47 Prozent der Fälle besteht eine Komorbidität mit einer Migräne, die genauen pathophysiologischen Mechanismen seien aber bislang ungeklärt. Womöglich liegt dem KSA eine Störung der zerebralen metabolischen Autoregulation zugrunde. Eine manifeste arterielle Hypertonie liegt nur bei acht Prozent der Betroffenen vor, dennoch finde man bei Personen, die an KSA leiden, einen stärkeren Blutdruckanstieg als bei gesunden Kontrollpersonen.
Hinsichtlich der Symptomatik könne „alles auftreten“: Die Schmerzen könnten dumpf drückend, messerstichartig oder pulsierend sein, außerdem könne er diffus verteilt oder frontal oder okzipital lokalisiert sein - offizielle Kriterien gebe es nicht, so Evers.
Therapie meist nicht notwendig
„Üblicherweise ist der KSA aber kein lebenslanges Problem“, fügte der Neurologe hinzu. Oft ließen die KSA nach mehreren Wochen ohne spezifische Therapie wieder nach.
Zwar helfe beispielsweise Indometacin sehr gut und auch Triptane seien bei 50 Prozent der Patientinnen und Patienten wirksam, doch meistens würden die Betroffenen auf die Einnahme verzichten, wenn sie von der Harmlosigkeit der Erkrankung erfahren. Prophylaktisch könne helfen, vor dem Geschlechtsverkehr Indometacin einzunehmen - auch wenn das ein wenig die Spontaneität störe - und eher eine eher passive Rolle einzunehmen. Auch eine etwas abgeschwächte Erregung könne helfen.
Betablocker könnten prophylaktisch eingesetzt werden, insbesondere bei Personen, die dauerhaft unter dieser Art von Kopfschmerzen leiden. „Betablocker sind wirklich wirksam in der Prophylaxe - nicht nur bei Männern, weil Betablocker auch Erektionsstörungen auslösen können“, erläuterte der Fachmann mit einem Augenzwinkern.
Abschließend betonte er aber nochmals, wie wichtig die Abgrenzung zu gefährlichen sekundären Kopfschmerzformen sei, wenn Betroffene sich mit der Erstmanifestation vorstellen.


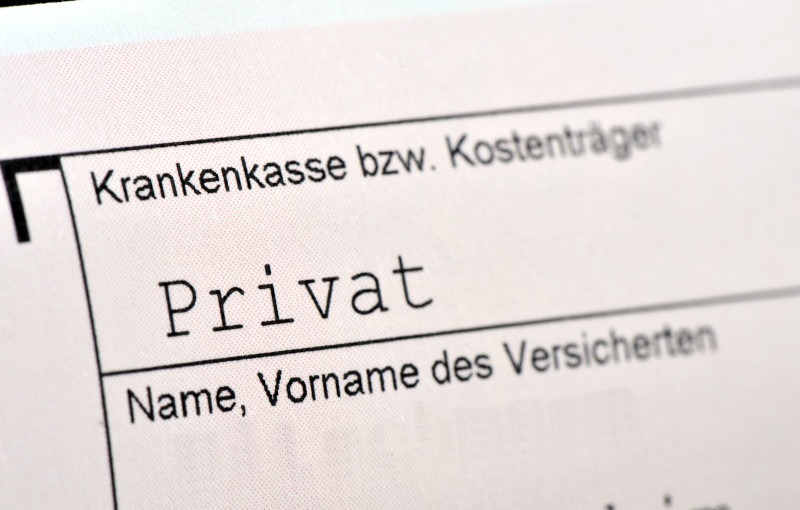

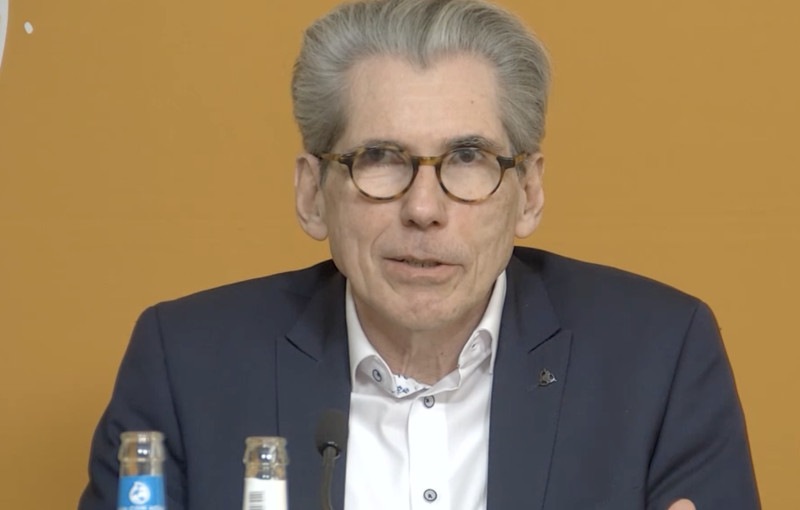

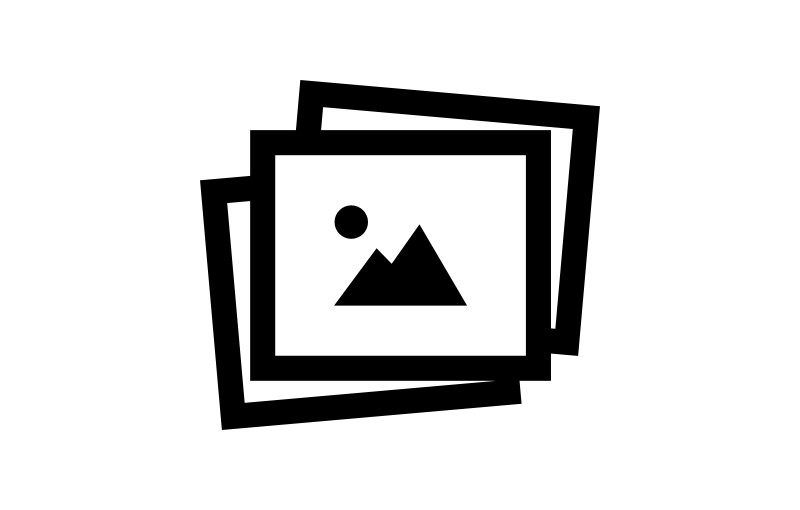Andrea Gaitanides_adobe_1481161567.jpg)

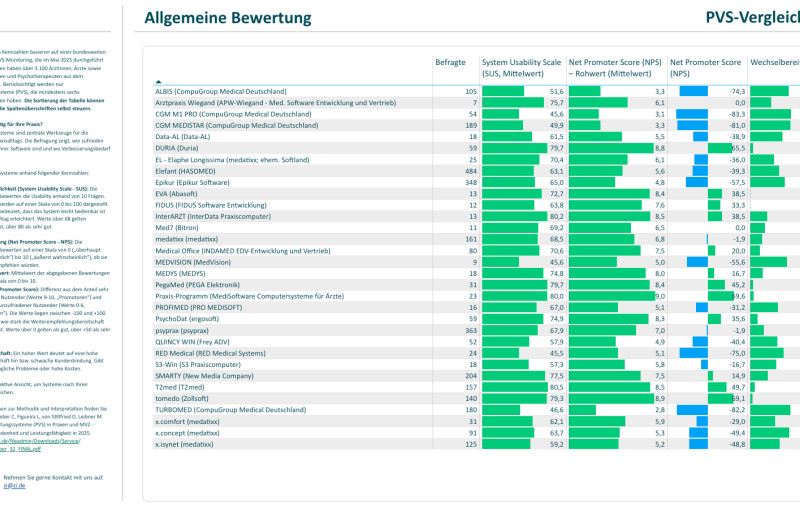
woravut_adobe_246321746.jpeg)






United States Department of Health and Human Services_888708448.png)



